Gerade einmal 0,3 Prozent unseres Stroms stammen aus Windenergie. Dabei könnte ein höherer Anteil von etwa 10 Prozent nicht nur Versorgungslücken im Winter schliessen, sondern jährlich bis zu 3 Milliarden Franken sparen. Führende Forscher und Energieexperten sind sich einig: Der Schweiz gehört in Sachen Windkraft endlich der Marsch geblasen.
Die Schweiz liebt ihr Selbstbild und schmückt es mit schmeichelnden Attributen: innovativ, nachhaltig, unabhängig, sicher, zuverlässig. Doch bei der Windkraft zeigt sie ein seltsam verzerrtes Gesicht – eines, das nicht zu diesen Werten passt. Geradezu absurd tief ist der Anteil der Windenergie an der inländischen Stromproduktion: 0,3 Prozent. Keine Marginalie, sondern Stillstand. In einem Land, das sich stolz auf seine Umweltpolitik beruft, kommt dieser Wert schon fast einem Offenbarungseid gleich. Während die Photovoltaik in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat und 14 Prozent im Schweizer Produktionsmix erreicht, wird die Windkraft regelrecht ausgebremst – durch sektiererische Bekämpfung, den immer wieder lähmenden föderalen Flickenteppich und eine angesichts der Klimakrise nur noch als grob fahrlässig zu bezeichnende Verweigerungshaltung.
«Weiter wie bisher» – auf Kosten der Nachwelt
Wer sind nun die Urheber dieses kläglichen energiepolitischen Versagens? Die Gegner der Windkraft in der Schweiz lassen sich wie folgt einkreisen:
Zum einen sind da die traditionellen und bis heute einflussreichen Strombarone, die jahrzehntelang – fast exklusiv – mit Strom aus Wasserkraft und Atomkraftwerken feudal wirtschaften konnten. Sie leben nach dem Motto «Weiter wie bisher» – zu einem guten Teil auf Kosten der Nachwelt.
Weiter sind in der Schweiz radikale, politisch versierte Umweltschützer-Gruppierungen am Werk, denen eines gemeinsam ist: eine geradezu museale Sichtweise auf unsere Landschaft. Dabei hat der Mensch, seit er dazu fähig ist, Landschaften immer wieder verändert. Während andere Länder Windenergie als Symbol des Fortschritts akzeptieren, überwiegt in Vereinen wie «Freie Landschaft Schweiz» der Widerstand aus einem rational nicht mehr nachvollziehbaren Konservierungsdrang in Bezug auf das Landschaftsbild.
Als dritte Gruppierung in dieser unheiligen Allianz macht gerade wieder die finanzkräftige Atomlobby von sich reden, der die Blockade gegen die Erneuerbaren Energien wie gerufen kommt und die seit dem Verpuffen des Fukushima-Effekts wieder Morgenluft wittert.
Last but not least ist selbstverständlich die noch viel finanzkräftigere Fossillobby zu nennen, die ihre klimaschädigenden Brennstoffe ungehindert ins Land pumpt und auf ihre äusserst lukrativen Geschäfte noch lange nicht verzichten will – in vorsätzlicher Ignoranz der Tatsache, dass die Energiewelt in der Endphase eines Kulturkampfs steckt: Gier gegen Gerechtigkeit, Zerstörung gegen Nachhaltigkeit, Zynismus gegen Empathie.
Nirgends zeigt sich das energiepolitische Dilemma in diesem Land deutlicher als in den Reaktionen auf die Klimakatastrophe: Hier jene, die altruistisch versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Dort jene, die alles tun, um aus dem rücksichtslosen Verheizen fossiler und nuklearer Brennstoffe weiterhin satten Profit zu ziehen.
All diese genannten Gruppierungen werden noch gestützt durch zahlreiche willfährige Politiker und Meinungsmacher aus dem reaktionären, rechtskonservativen Lager, die in einer Art Pawlowschen Reflexhaltung immer wieder ihre Abscheu gegenüber der Windenergie zum Ausdruck bringen.
Widerstand gegen fast alles
Nachtrag zu den Landschaftsschützern: Zu zwei Volksinitiativen hat Elias Vogt, Chefbremser des Vereins «Freie Landschaft Schweiz», kürzlich die nötigen Unterschriften im Bundeshaus deponiert: Die «Waldschutz»-Variante will Windräder in Wäldern generell verbieten. Obwohl gerade dort kein zusätzlicher Flächenverbrauch notwendig wäre: Der Wald bleibt erhalten, die Anlagen nutzen nur den Luftraum darüber.
Vogts zweite, zeitgleich eingereichte «Gemeindeschutz-Initiative» gibt jedem Schweizer Dorf ein Veto-Recht gegen Windkraft-Projekte. Ein demokratisches Meisterstück, das die Energiewende in über 2000 Mini-Volksabstimmungen zerteilt.
ETH-Klima-Experte Reto Knutti gibt ernüchtert zu Protokoll: «Die stimmberechtigte Bevölkerung in der Schweiz leistet fast allem gegenüber Widerstand. Keine Photovoltaik in den Bergen, keine Windprojekte, keine Wasserkraftprojekte, keine Autobahnen.»
Dass es bezüglich Windenergie auch anders geht, zeigt das Beispiel Österreich – ebenfalls eine Alpenrepublik mit grandiosen Landschaften und punkto Einwohnerzahl mit der Schweiz vergleichbar. Nur stehen in unserem östlichen Nachbarland bereits 1500 Windkraftanlagen. Die letzte Umfrage zeigt phänomenale 83 Prozent Zustimmung zur Windenergie bei der dortigen Bevölkerung.
Alarmzeichen auf Rot
Im Kontext der geopolitischen Unsicherheiten und des alternden AKW-Arsenals der Schweiz springen die Alarmzeichen indessen auf Rot. Unser Land steht gerade im Begriff, die Chance auf eine diversifizierte, wetterunabhängige und kosteneffiziente Stromversorgung im Einklang mit der Energiestrategie 2050 des Bundes zu verspielen.
Kein Wunder, dass wir in aktuellen Klimaschutz-Rankings massiv an Boden verlieren. 2024 belegte die Schweiz im Climate Change Performance Index (CCPI) nur noch den 33. Rang, was einen Abstieg von 12 Plätzen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. An der Spitze liegen Staaten wie die Niederlande – oder Dänemark mit einem sensationellen Windkraft-Anteil von 56 Prozent.
«Das sind Länder, in denen die Gesellschaft anstelle des Individuums im Vordergrund steht», sagt Knutti. «Man versucht, gemeinsam dafür zu sorgen, dass es allen gut geht und nicht nur ein paar wenigen. Das ist das, was es braucht, um die Probleme zu lösen.»
Überhaupt zeigt der Blick auf Europa längst ein völlig anderes Bild als in der Schweiz: Gilles Dickson, scheidender CEO des europäischen Dachverbands WindEurope, gibt eine erstaunliche Prognose ab: «Im Jahr 2050 wird Windenergie 50 Prozent der Stromerzeugung in der EU betragen. Bei einer Elektrifizierungsrate von 75 Prozent wird Windkraft einen immer grösseren Teil des Primärenergiemixes ausmachen. Gleichzeitig sinken die externen Kosten der Stromerzeugung deutlich, von 50 auf unter 20 Euro pro Megawattstunde.» Das ist gemäss aktuellem Wechselkurs ein Wert von knapp 1,9 Rappen pro Kilowattstunde.

Eine Voraussetzung zum Gelingen der Energiewende
Was hierzulande gerne verdrängt wird: Windkraft ist keine nette Option für besonders ambitionierte Klimaschützer – sie ist eine Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Gerade in den dunklen Wintermonaten, wenn Photovoltaikanlagen kaum Strom liefern, kann Windenergie ihre Stärken ausspielen. Sie ergänzt die Solarenergie ideal – und schliesst gefährliche Versorgungslücken, die sonst nur mit Speichertechnologien oder fossilem Zukauf zu überbrücken wären. Ohne Windkraft wird die Energiewende für die Schweiz nicht nur riskanter – sie wird deutlich teurer.
Roger Nordmann, Ex-SP-Nationalrat und anerkannter Spezialist für Energie- und Klimafragen, sagt: «Windkraft ist heimische, von der Natur gratis gelieferte Energie – also nicht kostspielig importiert oder zwischengelagert. Sie liefert im Winter deutlich mehr Strom als im Sommer. Das passt ausgezeichnet zur saisonalen Lücke, die durch geringere Solar- und Wasserkraftleistung entsteht.»
Immenses Sparpotenzial
Eine konservative Schätzung zeigt, was auch hierzulande möglich wäre: Würde die Schweiz 10 Prozent ihres Strommixes durch Windkraft abdecken, könnten die jährlichen Systemkosten der Energiewende bis 2040 um 2 bis 3 Milliarden Franken sinken – das entspricht 15 bis 20 Prozent der gesamten Stromsystemkosten. Umgekehrt gilt: Ohne Windkraft entstehen massive Mehrkosten – vor allem durch den notwendigen saisonalen Speicherbedarf und durch einen überproportionalen Ausbau der Photovoltaik. Der Preis? Etwa 30 Prozent höhere Kosten gegenüber einem diversifizierten Mix.
Aus Angst wird Verzicht – und der ist teuer
Warum also dieser hartnäckige Widerstand? Die Argumente sind stets die gleichen: Landschaftsschutz, Lärm, Schattenwurf. Doch vieles davon ist längst entkräftet. Moderne Windräder sind leise, effizient – und werden heute nur dort gebaut, wo sie sinnvoll sind. Die grössten Hürden liegen nicht in der Technik, sondern in Köpfen und Kommissionen. Es ist das Schweizer Prinzip der kleinräumigen Beharrung, das hier wirkt: jede Gemeinde ein Staat, jedes Hügelpanorama heilig, jede Veränderung ein Risiko.
Diese Mentalität mag in ruhigeren Zeiten ihren Charme gehabt haben. In Zeiten der Klimakrise ist sie ein riesiges Problem. Denn: Jeder nicht gebaute Windpark ist eine verpasste Chance. Und jeder zusätzliche Winter mit zu wenig erneuerbarem Strom bedeutet höhere Abhängigkeit, höhere Kosten – und mehr CO₂. Die Schweiz kann sich diesen Luxus nicht länger leisten. Wer heute den Ausbau der Windkraft bremst, handelt fahrlässig gegenüber künftigen Generationen.
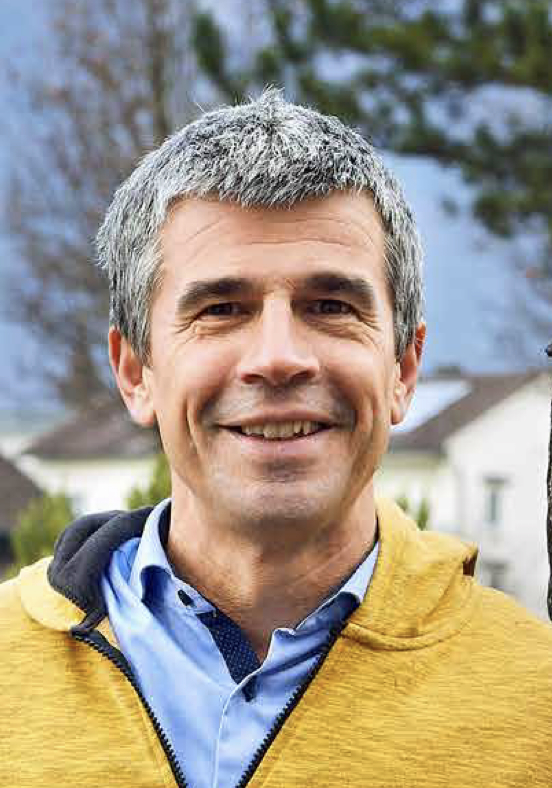
Intelligenter, pragmatischer Lösungsvorschlag
Boris Previšić, Kulturhistoriker und Autor des Klimabuchs «CO2: Fünf nach zwölf», hat eine so intelligente wie pragmatische Lösung in petto: «Am einfachsten wäre es, die Windkraft und alpine Photovoltaik entlang der heute bereits existierenden Starkstromleitungen, die von den alpinen Speicherseen und Pumpspeicherwerken ins Mittelland führen, zu installieren. Damit hätten wir gleich fünf Fliegen auf einen Schlag: Erstens müssen wir das Starkstromnetz nicht weiter ausbauen; zweitens hätten wir eine sichere Winterstromproduktion; drittens könnten wir die Speicherseen im Winter entlasten, damit sie im Sommer die Gletscher sinnvoll ersetzen; viertens können die Pumpspeicherwerke, die am selben Starkstromnetz angeschlossen sind, die Fluktuationen von Wind und Sonne über mehrere Tage hinweg ausgleichen. Und fünftens müssten wir nicht zusätzliche Täler fluten und könnten die heutigen Speicherseen für verschiedene Nutzungen multipel im Winter und Sommer brauchen.»
Jetzt handeln – nicht irgendwann
In Sachen Windkraft gehört der Schweiz also endlich der Marsch geblasen. Die Windkraft muss endlich ihren Platz in unserer Energiezukunft finden. Nicht als nette Ergänzung – sondern als tragende Säule einer sicheren, nachhaltigen und kosteneffizienten Stromversorgung. Es braucht eine nationale Kraftanstrengung, ähnlich wie beim Ausbau der Solarenergie. Planungshorizonte sind zu verkürzen, Verfahren zu vereinfachen, Vorbehalte mit Fakten zu entkräften. Die Energiewende ist keine theoretische Übung – sie ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und dieser Wettlauf wird nicht gewonnen mit «Weiter so», sondern mit klarem politischem Willen und gesellschaftlichem Mut.
Wir brauchen diesen Mut. Nicht nach der nächsten Dürre oder dem nächsten Gaskonflikt. Sondern heute. Die Technologie ist da. Die Argumente sind da. Die ökonomischen Vorteile sind belegt.
Wer Windkraft blockiert, gefährdet die Schweiz
Die Schweiz hat das Know-how, die Ressourcen und die Innovationskraft, um eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Energieversorgung zu übernehmen. Aber dafür muss sie endlich aufhören, die Windkraft zu meiden. Es geht nicht mehr um Ideologie, nicht um Ästhetik – es geht um Verantwortung.
Windkraft ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Wer sie weiterhin ignoriert, riskiert eine energiepolitische Sackgasse – mit hohen Kosten, grosser Abhängigkeit und wachsender Unsicherheit. Die Frage ist nicht mehr, ob wir Windkraft brauchen. Die Frage ist: Wann fangen wir endlich an?
Die Antwort muss lauten: Jetzt.
Sie wünschen zur Windkraft unterschiedliche Sichtweisen? Lesen Sie Windkraftwerke bringen Schweizer Wälder und Demokratie in Gefahr auf SICHTWEISENSCHWEIZ.CH
Kurzporträt Andreas Turner

Bildnachweis: Titelbild Pixabay








Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.