Vom Kraftwerk zum Kraftfeld: In ENERGY BY TURNER trifft Andreas Turner auf Menschen, die Energie als physikalische GrÃķsse, Triebfeder oder kulturelle Errungenschaft verhandeln. PrÃĪgnant. PersÃķnlich. Perspektivisch.
Professsor Mathias Binswanger ist GlÞcksforscher und Professor fÞr Volkswirtschaft an der Fachhochschule Norwestschweiz.
Herr Binswanger, welches Stromprodukt kommt bei Ihnen zu Hause aus der Steckdose?
ÂŦDas weiss ich gar nicht so genau, und das ist irgendwie symptomatisch. Denn die wenigsten Menschen wollen einen Grossteil ihrer Freizeit dafÞr aufwenden, Þberall herauszufinden, was nun wirklich das beste â sprich nachhaltigste oder gÞnstigste â Angebot ist. Wie ich schon in meinem Buch ÂŦDie TretmÞhlen des GlÞcksÂŧ ausfÞhre, ist es heute vÃķllig unmÃķglich, alles immer optimal zu entscheiden. Es gibt zu viele Informationen, und sobald ich anfange, irgendwo zu optimieren, zahle ich zwangslÃĪufig mit Zeitnot bei anderen Entscheidungen.Âŧ
Ist saubere Energie denn kein wichtiger Puzzlestein, der zum GlÞck des Menschen beitragen kann?
ÂŦDazu mÞsste ich schon selber entsprechende AktivitÃĪten entwickeln â indem ich etwa eine kleine Produktionseinheit erneuerbarer Energie ans Netz bringe. Wer aber nur dieses oder jenes Energiepaket bezieht, wird sein GlÞck dadurch kaum steigern.Âŧ
Ist der Einsatz von erneuerbaren Energien Þberhaupt ein Garant fÞr mehr Nachhaltigkeit?
ÂŦNein. Man reduziert die Nachhaltigkeitsdiskussion gerne auf den Anteil erneuerbarer EnergietrÃĪger am Gesamtverbrauch. Das ist aber eine vÃķllig verkÞrzte Sichtweise. Nachhaltigkeit ist immer von Fall zu Fall zu betrachten: In einem Land wie der Schweiz kann es sogar kontraproduktiv sein, erneuerbare Energien auf Biegen oder Brechen durchsetzen zu wollen. Denn wenn etwa Windenergie mit Landschaftsschutz oder Tierschutz in Konflikt kommt, ist das nicht mehr zwingend nachhaltig.Âŧ
Gewinne bei der Energieeffizienz werden erfahrungsgemÃĪss rasch wieder zunichte gemacht. Beispielsweise verbrauchen elektrische GerÃĪte zwar weniger Strom, dafÞr werden mehr davon gekauft. Sind wir solchen Rebound-Effekten hilflos ausgeliefert?
ÂŦVieles deutet darauf hin, denn jeder Effizienzgewinn schafft tatsÃĪchlich eine neue Nische. Und da wir in einer Wirtschaft leben, die auf Wachstum ausgerichtet ist, wird sofort versucht, diese Nische zu besetzen. Der entscheidendste Rebound-Effekt bezieht sich wohl auf den Faktor Zeit. Beispiel: Wird der Verkehr schneller â durch Strassenausbau oder HochgeschwindigkeitszÞge â, reist der Mensch einfach hÃĪufiger und legt weitere Distanzen zurÞck. Das erklÃĪrt auch, weshalb die Zeitdauer pro Tag, die fÞr MobilitÃĪt aufgewendet wird, statistisch gesehen immer ungefÃĪhr konstant bleibt.Âŧ
Studien sagen, Schweizer seien im internationalen Vergleich Þberdurchschnittlich glÞcklich. Wer sich morgens in der S-Bahn umschaut, erhÃĪlt allerdings einen anderen Eindruck. Woher rÞhrt diese Diskrepanz?
ÂŦBesucher aus dem Ausland gewinnen bei uns tatsÃĪchlich nicht den Eindruck, die Schweizer seien ein besonders glÞckliches Volk. Menschen tendieren dazu, ihr GlÞck oder ihre Zufriedenheit bei Umfragen zu ÞberschÃĪtzen. Das ist der sogenannte Social Desirability Bias. Dieser scheint in der Schweiz speziell hoch ausgeprÃĪgt zu sein â so nach dem Motto: ÂŦWenn man alles hat, muss man doch zufrieden seinÂŧ.Âŧ
Wir leben in der Tradition, dass Genussmomente immer erst erarbeitet werden wollen. Ein Stolperstein fÞr echtes GlÞck?
ÂŦJa und nein. Permanentes Nichtstun ist sicher kein GlÞcksfaktor. GlÞck und Zufriedenheit in unserer Kultur stellen sich vor allem ein, wenn nach Þberdurchschnittlicher Anstrengung das GefÞhl aufkommt, wir hÃĪtten eine gute Leistung erbracht. Die Gefahr besteht jedoch, diesen Aspekt ins Extreme zu kultivieren, indem wir immer mehr leisten und uns nie zufriedengeben. So wird das Streben nach permanenter HÃķchstleistung zu einer GlÞcksbremse.Âŧ
Gewinn, Effizienz, Innovation, WettbewerbsfÃĪhigkeit gelten als Elemente der wirtschaftlichen Heilsbotschaft. Zudem sind wir sehr stark vom Wachstumsgedanken geprÃĪgt. Wohin fÞhrt diese Haltung letztendlich?
ÂŦEigentlich ginge es darum, ein mÃķglichst gutes Leben zu fÞhren. Die Mittel, um dies zu erreichen, sind inzwischen aber zum Selbstzweck geworden. Wenn ich wettbewerbsfÃĪhiger bin, dann ist das per se schon gut. Und wenn ich innovativ bin, ist das ebenfalls gut, ohne zu wissen warum und wozu. Diese Mechanismen haben sich quasi verselbststÃĪndigt. Wenn wir uns aber abrackern, ohne zu wissen wofÞr, dann haben GlÞck und Zufriedenheit einen schweren Stand.Âŧ
Sollte man statt nach GlÞck einfach nach einem erfÞllten Leben streben?
ÂŦMit diesen grundsÃĪtzlichen Fragen beschÃĪftigt sich die Philosophie schon seit Jahrtausenden. Ist es besser, mÃķglichst gleichmÞtig dahinzuleben â ohne besondere GlÞcksmomente, aber auch ohne Phasen des UnglÞcklichseins? Oder ist das Wechselbad der GefÞhle anzustreben â mit Momenten hÃķchsten GlÞcks, aber auch ganz extremen Tiefs? Die klassische Philosophie der Stoiker vertritt den Ansatz, es sei besser, eine gleichmÞtige Haltung zu entwickeln. Denn die GlÞcksmomente wÞrden die UnglÞcksmomente niemals aufwiegen. Es gibt aber andere Philosophen wie Nietzsche, die sagten, es komme nur auf die GlÞcksmomente an.Âŧ
Welche gesellschaftspolitischen Folgerungen sind daraus zu ziehen?
ÂŦDa sich nicht festlegen lÃĪsst, was GlÞck im Einzelfall genau ist, sollte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen â nÃĪmlich die Gesellschaft so zu gestalten, dass es den Menschen mÃķglichst leicht gemacht wird, ein glÞckliches Leben zu fÞhren. Herrscht etwa eine extreme Ranking-Kultur, wo die Menschen stÃĪndig dazu angehalten werden, sich mit anderen zu vergleichen, dann wird ein glÞckliches Leben dadurch erschwert. Âŧ
In Ihrem neuen Buch ÂŦDie VerselbststÃĪndigung des KapitalismusÂŧ plÃĪdieren Sie fÞr die Beibehaltung analoger Systeme und Prozesse. Weshalb?
ÂŦWeil wir uns sonst von den Entscheidungen KI-gesteuerter Algorithmen abhÃĪngig machen. Diese stellen eine ÂŦBlack BoxÂŧ dar und wir wissen nicht, warum KI in einer bestimmten Situation so oder so entscheidet. Und wir wissen ebenso wenig, welche wirtschaftlichen Interessen genau hinter den Algorithmen stecken und ob wir nicht digital Þbers Ohr gehauen werden. Deshalb ist es wichtig, weiterhin Alternativen zu haben. Beispielsweise sollte kÞnftig niemand dazu gezwungen werden, in einem ÂŦSmart HomeÂŧ zu leben, wo es zwar eine optimierte Energieversorgung gibt, wo man aber unweigerlich von KI abhÃĪngig wird.Âŧ
Zeugt es von purer Bequemlichkeit oder gar von menschlicher Dummheit, der KÞnstlichen Intelligenz immer mehr Raum zu geben?
ÂŦEs gibt vor allem zwei Argumente, mit denen KI den Menschen schmackhaft gemacht wird. Das ist tatsÃĪchlich zum einen die Bequemlichkeit. Wir mÞssen nicht mehr mÞhsam selbst das beste Produkt aus einem riesigen Angebot im Internet aussuchen â KI-gesteuerte Shopping-Agenten erledigen das besser und schneller. Und wir mÞssen auch keine Texte mehr selbst formulieren, denn auch das kann die KI. Das zweite Argument ist Sicherheit. KI verspricht Sicherheit durch vollstÃĪndige Ãberwachung von RÃĪumen, Prozessen und Menschen â sowie aus den gewonnenen Daten abgeleitete Sicherheitsmassnahmen. Was dann auf der Strecke bleibt, sind Freiheit und PrivatsphÃĪre.Âŧ
Was macht dieser verdichtete Mix aus Digitalisierung, KÞnstlicher Intelligenz und kapitalistischer Wirtschaft lÃĪngerfristig mit uns?
ÂŦDer Mensch wird vom handelnden Subjekt zunehmend zum optimierten Objekt. Aus KonsumentensouverÃĪnitÃĪt wird Algorithmen-AbhÃĪngigkeit. Viele Dinge werden tatsÃĪchlich einfacher, schneller und effizienter â es gibt zum Beispiel gewaltige Verbesserungen in der medizinischen Diagnostik. Aber wir durchschauen die Welt immer weniger und werden fremdgesteuert, ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst sind.Âŧ
KurzportrÃĪt Mathias Binswanger

Buchempfehlung
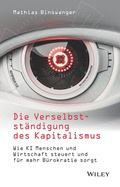
ÂŦDie KÞnstliche Intelligenz ist effizienter als der MenschÂŧ, sagt Mathias Binswanger. ÂŦGleichzeitig sind die VorgÃĪnge, welche die KI zu ihren Ergebnissen fÞhrt, nicht mehr zu verstehen, geschweige denn zu kontrollieren.Âŧ Was bedeutet das im Alltag fÞr KonsumentInnen, Arbeitnehmende und Firmen?
KurzportrÃĪt Andreas Turner

Dieses fÞr SICHTWEISENSCHWEIZ.CH aktualisierte Interview erschien zuerst im Magazin ÂŦsmartÂŧ.
Fotos: Markus Lamprecht








Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.