Der erst 28-jГӨhrige Samuel Fitoussi hat ein bemerkenswertes zweites Buch geschrieben, das von kognitiver Psychologie, Soziologie und Ideengeschichte geprГӨgt ist. In seiner kecken und scharfsinnigen Art geht er einem zeitgenГ¶ssischen RГӨtsel nach: Warum haben sich so viele Intellektuelle – vor allem im letzten Jahrhundert – schwer geirrt? Und warum verbreiten sie auch heute noch fragwГјrdige Ideen, ohne jemals den Preis fГјr ihre Fehler zu zahlen? Das Interview mit Samuel Fitoussi fГјhrt Yann Costa.
Yann Costa: Der Autor des dystopischen Romans 1984, George Orwell, den Sie in Ihrem Buch mehrfach zitieren, sagte, dass «manche Ideen so absurd sind, dass nur Intellektuelle daran glauben können». Worauf bezog er sich damit?
Samuel Fitoussi: В«Orwell stellte zu Recht fest, dass die Intelligenz unter bestimmten Bedingungen zu IrrtГјmern neigt. Er selbst musste dies am eigenen Leib erfahren. Der britische Autor fand keinen Verleger fГјr seinen Roman В«Farm der TiereВ», weil es sich um eine antistalinistische Satire handelte. Die westliche Intelligenz, so kommentierte er, habe eine В«nationalistische LoyalitГӨtВ» gegenГјber der UdSSR entwickelt. Selbst in den USA weigerten sich die grossen New Yorker Verlage, ErzГӨhlungen zu verГ¶ffentlichen, die das postrevolutionГӨre Russland kritisierten, insbesondere die von Ayn Rand. Die gleiche Blindheit galt auch fГјr den Nationalsozialismus: Heidegger, Carl Schmitt und viele Akademiker unterstГјtzten Hitler aktiv. Auf der Wannsee-Konferenz hatte die HГӨlfte der Teilnehmer einen Doktortitel. SpГӨter schwГӨrmten die gleichen Eliten fГјr Mao, wie Simone de Beauvoir, die ein ganzes Buch Гјber ihn schrieb.В»
Sie erklГӨren, dass diese Fehler auf einen Konflikt zwischen zwei Arten von RationalitГӨt zurГјckzufГјhren sind: der epistemischen und der sozialen RationalitГӨt. Wie definieren Sie diese?
Samuel Fitoussi: В«Die epistemische RationalitГӨt ist diejenige, die uns dazu bringt, nach dem zu suchen, was wahr ist. Die soziale RationalitГӨt hingegen lГӨsst uns die Ideen Гјbernehmen, die uns sozial gut dastehen lassen, d. h. die von anderen als wahr angesehen werden. Diese beiden Arten der RationalitГӨt stehen in jedem von uns in einem stГӨndigen Wettstreit.В»
Sie deuten an, dass bei Intellektuellen die soziale RationalitГӨt oft die Oberhand gewinnt. Warum ist das so?
Samuel Fitoussi: В«Erstens sind sie aufgrund ihrer kognitiven FГӨhigkeiten in der Lage, jeden noch so falschen Glauben zu rationalisieren: Wo andere auf Ungereimtheiten stossen wГјrden, gelingt es Intellektuellen, ausgefeilte Argumentationen zu entwickeln, um AbsurditГӨten zu verteidigen. Zweitens bilden ihre Ideen den Kern ihrer beruflichen und sozialen IdentitГӨt – sie in Frage zu stellen, bedeutet, ihren Ruf, ihr Netzwerk und sogar ihr Einkommen zu riskieren. Ausserdem haben sie im Gegensatz zu anderen Berufen in der Regel nicht mit den negativen Folgen ihrer Fehler zu kГӨmpfen.В»
Was bedeutet das?
Samuel Fitoussi: В«Ein BГӨcker weiss sofort, wenn sein Brot nicht gelingt: Er verliert seine Kunden. Ein Pilot, der viele Fehler macht, stГјrzt irgendwann ab und stirbt mit seinem Flugzeug. Ein Intellektueller hingegen kann jahrzehntelang Unsinn vertreten, ohne jemals den Preis dafГјr zu zahlen. Dies geschieht aus zwei GrГјnden. Zum einen, weil seine Vorhersagen oft langfristig sind und auf komplexen Verkettungen von Ursache und Wirkung beruhen, ist es schwierig, wenn nicht gar unmГ¶glich, sie empirisch zu entkrГӨften. Selbst als das Scheitern des Maoismus offensichtlich war (HungersnГ¶te, UnterdrГјckung, zig Millionen Tote), wurde er von Personen wie Simone de Beauvoir im Namen eines hГ¶heren Ideals, das die Opfer rechtfertigen sollte, weiterhin gelobt.В»
Und ich kann mir vorstellen, dass je sicherer das Umfeld wird, in dem man sich bewegt – typischerweise in den entwickelten LГӨndern, in denen sich Intellektuelle bewegen -, desto mehr tendiert die soziale RationalitГӨt dazu, die epistemische RationalitГӨt zu Гјbertrumpfen.
Samuel Fitoussi: В«Genau das ist der Fall. In einer feindlichen Umgebung ist die epistemische RationalitГӨt lebenswichtig: Fehlentscheidungen kГ¶nnen Sie teuer zu stehen kommen, manchmal sogar Ihr Leben kosten. Je wohlhabender eine Gesellschaft also aufgrund ihrer rigorosen, durch epistemische RationalitГӨt gewonnenen Einsichten wird, desto mehr beginnt sie, die soziale RationalitГӨt zu bevorzugen … und untergrГӨbt damit die Grundlagen, die diesen Wohlstand Гјberhaupt erst ermГ¶glicht haben.В»
В«Liberale Intellektuelle haben auf dem В«Markt der IdeenВ» einen Nachteil:
Samuel Fitoussi
Ihre Ideen sind weniger verfГјhrerisch, weniger romantisch.
Sie sind weniger sexy als ein grosses revolutionГӨres Versprechen.В»
Intellektuelle zeichnen sich also nicht durch ihre FГӨhigkeit aus, die besten Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern durch ihre FГӨhigkeit, jede Idee zu rationalisieren, auch die schlimmsten. Warum werden diese Ideen populГӨr, obwohl sie der epistemischen RationalitГӨt widersprechen?
Samuel Fitoussi: В«Weil eine Idee sozial erfolgreich sein kann, ohne wahr zu sein. Beispielsweise gefallen Intellektuellen bestimmte, oft kollektivistische Ideen, weil sie ihnen eine aufgewertete Rolle verleihen: die Rolle der Sozialingenieure, die die Gesellschaft verГӨndern sollen. Sie kГ¶nnen sich als Architekten einer Utopie begreifen. In einer liberalen Vision, in der die Gesellschaft das spontane Ergebnis des freiwilligen Austauschs zwischen den Individuen ist, ist ihre Rolle bescheidener, oft beschreibend, was weniger lohnend ist.В»
Geht es also nur um Macht?
Samuel Fitoussi: «Ich würde das nicht so zynisch sehen. Es ist menschlich. Wenn man einen Beruf ausübt, möchte man glauben, dass er nützlich ist. Die Vorstellung, dass Fortschritt durch die Entdeckung des Rezepts für eine gute Gesellschaft erreicht wird, gibt der Arbeit von Intellektuellen einen Sinn. Und per Definition bieten Utopien dieses Versprechen.»
Dennoch gibt es auch liberale Intellektuelle.
Samuel Fitoussi: В«NatГјrlich gibt es sie. Aber liberale Intellektuelle wie Raymond Aron haben auf dem В«Markt der IdeenВ» einen Nachteil: Ihre Ideen sind weniger verfГјhrerisch, weniger romantisch. Sie beruhen auf stГӨndigen AbwГӨgungen und Kompromissen, die zwangslГӨufig unbefriedigend sind. Sie rufen eher zu Vorsicht und Bescheidenheit auf. Sie sind weniger sexy als ein grosses revolutionГӨres Versprechen. Warum war es besser, mit Sartre falsch zu liegen als mit Aron richtig? Aron selbst antwortete: В«Die Intelligenzia ist noch nicht bereit, mir zu verzeihen, dass ich nicht den Weg zur guten Gesellschaft Г¶ffne und nicht versuche, die Methode zu lehren, um dorthin zu gelangen.В»
Sie erwГӨhnen in Ihrem Buch das Konzept der Oikophobie – das Gegenteil von Fremdenfeindlichkeit -, das die Faszination mancher Intellektueller fГјr tyrannische Regime erklГӨren soll.
Samuel Fitoussi: В«Bereits in den 1940er Jahren prangerte Orwell die Anglophobie der britischen Intelligenz an. Der linke Intellektuelle, so stellte er humorvoll fest, wГјrde lieber beim Stehlen aus einer Spendenbox fГјr die Armen gesehen werden, als beim Singen der Nationalhymne mit der Hand auf dem Herzen. Nach ihm sprach Roger Scruton von der Oikophobie westlicher Intellektueller und bedauerte, dass die britische Geschichte in der Schule als eine Reihe von Verbrechen gelehrt werde, die man bereuen mГјsse. Es ist jedoch die Ablehnung der eigenen Kultur, die zur Idealisierung fremder Regime, einschliesslich der gewalttГӨtigsten, fГјhrt.В»
Diese kritische Haltung gegenГјber der eigenen Nation ist ein Mittel, um an Prestige zu gewinnen, insbesondere unter Linksintellektuellen.
Samuel Fitoussi: В«Ja. Steven Pinker schlГӨgt vor, sich vorzustellen, dass die Intelligenzia in einem Wettstreit mit anderen BevГ¶lkerungsgruppen im Kampf um moralisches Prestige engagiert ist. Indem sie die Gesellschaft, in der sie leben, anprangern, beschreiben die Intellektuellen die Politiker als inkompetent, die Unternehmer als von egoistischen Interessen getrieben, die Journalisten als verantwortungslos, das Volk als blind und Opfer eines falschen Bewusstseins, die KГјnstler als TrГӨger schГӨdlicher Botschaften und die vergangenen Generationen als gescheitert. Indem sie andere abwerten, werten die Intellektuellen im Gegensatz dazu sich selbst auf.В»
Besteht auf der rechten Seite nicht das umgekehrte Risiko, aus Patriotismus zu sГјndigen?
Samuel Fitoussi: В«Absolut, auch auf der Rechten gibt es irrationale Reflexe – wie man an der Faszination fГјr Putin seit den 2010er Jahren sehen kann. Ich misstraue vor allem der Tendenz, auf alle Themen, einschliesslich der Wirtschaft, dieselben Raster anzuwenden, was zu schwerwiegenden Fehlern fГјhren kann. Beispielsweise muss eine kritische Haltung gegenГјber der Einwanderung (Feindschaft gegenГјber der FreizГјgigkeit von Personen) nicht automatisch bedeuten, dass man gegen den Freihandel (Feindschaft gegenГјber dem Austausch von Waren) ist. Heute scheinen einige, wie die Trumpisten, eine logische Г„quivalenz zwischen den beiden Positionen herzustellen. Es ist wichtig, von Thema zu Thema zu argumentieren und sich nicht einem В«PaketВ» von Ideen anzuschlieГҹen, die denen eines Lagers entsprechen und denen man automatisch zustimmt.В»
В«Wenn eine einzige Idee vorherrscht, sind die sozialen Kosten einer Abweichung so hoch, dass jeder psychologisch dazu angehalten ist, nicht nach der Wahrheit zu suchen, sondern den herrschenden Konsens zu rationalisieren.В»
Samuel Fitoussi
Wenn man die jГјngste Wahl von Donald Trump und die allgemeine elitenfeindliche Stimmung betrachtet, scheint es, als wГјrden Sie den Einfluss der Intellektuellen ГјberschГӨtzen.
Samuel Fitoussi: В«Der Einfluss der Intellektuellen lГӨsst sich nicht an Wahlergebnissen messen. Die Intelligenz beeinflusst unverhГӨltnismГӨssig stark die Richtung, die ihr Land einschlГӨgt, vor allem, weil sie mit denjenigen spricht, die die Macht haben, Г¶ffentliche Gelder umzuverteilen, BildungsprioritГӨten festzulegen oder die Г¶ffentliche Debatte zu lenken. Ihr Einfluss erfolgt also nicht nur Гјber die Wahlurne, sondern auch Гјber andere KanГӨle: die Verwaltung, staatliche ZuschГјsse und kulturelle Normen. Selbst wenn die Mehrheit nicht fГјr die Ideen der Elite stimmt, kГ¶nnen sich diese trotzdem durchsetzen.В»
Um dieses Problem zu lГ¶sen, fordern Sie mehr Pluralismus an den UniversitГӨten. Sollte man dann in den Geographieabteilungen versuchen, Platisten zu rekrutieren? Sollte an den UniversitГӨten nicht eher die Strenge der Ideen als ihre Vielfalt im Vordergrund stehen?
Samuel Fitoussi: В«Ich verstehe Ihren Einwand. Es geht mir nicht darum, Pluralismus Гјberall und um jeden Preis durchzusetzen. Aber in bestimmten Kontexten ist Pluralismus eine Voraussetzung fГјr RationalitГӨt. Wenn nГӨmlich eine einzige Idee vorherrscht, sind die sozialen Kosten einer Abweichung so hoch, dass jeder psychologisch dazu angehalten ist, nicht nach der Wahrheit zu suchen, sondern den herrschenden Konsens zu rationalisieren. Wenn hingegen alle Meinungen vertreten sind, kann jeder seine Гңberzeugungen eher nach ihrem epistemischen als nach ihrem sozialen Wert auswГӨhlen.В»
Sie weisen auf den Unterschied hin zwischen dem, was mit einer Theorie vereinbar ist, und dem, was diese Theorie empirisch bestГӨtigt. Dieser Fehler wГјrde erklГӨren, warum das Informationszeitalter, anders als man erwarten wГјrde, ein fruchtbarer Boden ist, um unsere Zustimmung zu zutiefst irrtГјmlichen Ideen zu verstГӨrken.
Samuel Fitoussi. В«Ja. Manche meinen zum Beispiel, dass die Existenz von rund 100 Feminiziden (gemeint sind Morde an Frauen durch ihre Ehepartner) pro Jahr in Frankreich beweisen wГјrde, dass wir in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. In Wirklichkeit ist diese traurige statistische Tatsache mit der Patriarchatstheorie vereinbar, aber sie ist keine BestГӨtigung dafГјr, denn selbst in einer nicht-patriarchalischen Gesellschaft kГ¶nnte es weiterhin Frauenmorde geben, einfach weil es eine Minderheit gewalttГӨtiger MГӨnner gibt. Ebenso ist die Beobachtung prekГӨrer wirtschaftlicher VerhГӨltnisse im Westen mit der Hypothese des Scheiterns des Kapitalismus vereinbar, aber sie ist keine BestГӨtigung, da sie neben einer anderen Beobachtung (der deutlichen Verringerung der Armut Гјber mehrere Jahrzehnte hinweg) bestehen kann, die die Theorie widerlegen wГјrde. Leider mГјssen wir nur ein Element finden, das mit einer Theorie, die uns gefГӨllt, vereinbar ist, um sie fГјr bewiesen zu halten. Das ist einer der GrГјnde, warum es so schwer ist, seine Meinung zu ГӨndern.В»
Sind Sie der Meinung, dass die Struktur der heutigen UniversitГӨten, die auf Spezialisierungen ausgerichtet sind, dieses PhГӨnomen verstГӨrkt?
Samuel Fitoussi: В«Ja, genau das ist der Fall. Der sogenannte В«confirmation biasВ» ist nicht wirklich ein Bias, sondern lГӨsst sich aus evolutionГӨrer Sicht gut erklГӨren. Die Forscher Hugo Mercier und Dan Sperber zeigen, dass es in vorindustriellen Gesellschaften effizient war, wenn ein Individuum Argumente fГјr die eigene Position sammelte, wГӨhrend ein anderes Individuum das Gleiche fГјr die Gegenposition tat. Durch die GegenГјberstellung in der Debatte konnte der Stamm dann eine Entscheidung treffen. Heute gibt es keine kontroverse Debatte mehr, sondern jeder ist in einer Schleife der ewigen SelbstbestГӨtigung gefangen. In Harvard zum Beispiel bezeichnen sich nur 3% der Professoren als konservativ. Das schafft einen NГӨhrboden fГјr IrrationalitГӨt.В»
Sie erwГӨhnten vorhin an den Beispielen eines BГӨckers und Piloten das von Nassim Taleb geprГӨgte Konzept der fehlenden вҖһHaut im SpielвҖң, demzufolge Intellektuelle nicht вҖһum ihre Haut spielenвҖң und somit nicht fГјr die Folgen ihrer Fehler bezahlen. Sollten Intellektuelle stГӨrker fГјr ihre Fehler verantwortlich gemacht werden?
Samuel Fitoussi: В«Ich denke nicht, dass sie fГјr ihre Fehler bestraft werden sollten. Das wГӨre ein rutschiger Abhang. Man sollte jedoch bedenken, dass, wie Thomas Sowell zeigt, diejenigen, die nicht fГјr ihre Fehler bezahlen, eine hГ¶here Wahrscheinlichkeit haben, Fehler zu machen. Daher sollte es vermieden werden, ihnen die Entscheidungsgewalt zu Гјbertragen. Eine Zentralisierung beispielsweise entzieht den BГјrgern oder lokalen Gemeinschaften die Macht und konzentriert sie in den HГӨnden weit entfernter Instanzen, die nicht rechenschaftspflichtig sind. Ebenso kann ein gewГӨhlter Politiker regelmГӨssig durch die WГӨhlerschaft abgestraft werden, wГӨhrend ein anonymer Beamter manchmal unsinnige oder teure Regulierungen durchsetzen kann, ohne jemals selbst die Konsequenzen seiner Fehler tragen zu mГјssen. BГјrokraten setzen niemals ihre eigene Haut aufs Spiel.В»
Ein anderer Ansatz wГӨre, sich so zu organisieren, dass epistemische RationalitГӨt sozial belohnt wird. Ist das mГ¶glich?
Samuel Fitoussi: В«Das ist das Ziel der wissenschaftlichen Methode: Die soziale Anerkennung mit der Suche nach Wahrheit in Einklang zu bringen. Ein Mathematiker, der ein Theorem beweist, wird geschГӨtzt. In den Sozialwissenschaften, wo es keine klaren ГңberprГјfungskriterien gibt, ist diese Anpassung jedoch schwieriger. Wir sind davon Гјberzeugt, dass wir von der Wahrheitssuche (epistemische RationalitГӨt) angetrieben werden, auch wenn unsere Vernunft uns zur Rationalisierung falscher und konsensfГӨhiger Гңberzeugungen fГјhrt.В»
Sie gehören selbst zu dieser Klasse von Intellektuellen, die Sie kritisieren. Was tun Sie, um nicht in die von Ihnen beschriebenen Fallen zu tappen?
Samuel Fitoussi: В«Ich tappe zweifellos in einige der Fallen, die ich kritisiere! IrrationalitГӨt ist eine Gefahr fГјr alle. Es stimmt zum Beispiel, dass ich als Rechtsliberaler vor allem die Denkfehler der Linken und der illiberalen Intellektuellen analysiere. Aber mein Ziel ist es, von Thema zu Thema zu argumentieren und die Ideen zu Гјbernehmen, die ich fГјr richtig halte.В»
Glauben Sie, dass uns die Politik zwangslГӨufig zur IrrationalitГӨt verleitet?
Samuel Fitoussi: В«In gewissem Masse ja, die Politik aktiviert unsere Stammesinstinkte. Sie institutionalisiert den Clanreflex. Jonathan Haidt zeigt, dass wir in der Politik zu Mediensprechern werden: Wir argumentieren nicht, um herauszufinden, was wahr ist, sondern um die Гңberzeugungen unseres Teams zu verteidigen. Die Politik bringt uns dazu, post-hoc zu argumentieren und gegnerische Argumente automatisch abzulehnen, selbst um den Preis einer gehГ¶rigen Portion BГ¶sglГӨubigkeit.В»
Sie schliessen Ihr Buch mit einem PlГӨdoyer fГјr die Meinungsfreiheit, in dem Sie sich besonders kritisch Гјber den Kampf gegen вҖһFake NewsвҖң ГӨussern. Inwiefern ist dies mit der Suche nach Wahrheit vereinbar?
Samuel Fitoussi: В«Die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Meinungen ist oft unklarer als man denkt. Diejenigen, die behaupten, die Fakten zu verteidigen, haben manchmal selbst eine ideologische Lesart. Dass Covid-19 aus einem Labor stammt, galt lange Zeit als Fake News oder sogar als VerschwГ¶rungstheorie – heute ist es eine glaubwГјrdige Hypothese. Dies zeigt: Wer die Entscheidungsbefugnis inne hat, etwas als Tatsache zu definieren und zugleich den Diskurs darГјber zu unterbinden, verfГјgt Гјber eine exorbitante Macht. Diese steht heute hГӨufig einer kulturellen, politischen oder technokratischen Elite zu. Was ich in meinem Buch zeige, ist, dass diese Elite nicht nur fehlbar ist – sie irrt sich sehr oft, und manchmal sogar gewaltig!В»
Hannah Arendt sagte, dass В«die Meinungsfreiheit eine Farce ist, wenn die Information Гјber die Fakten nicht gewГӨhrleistet ist und wenn nicht die Fakten selbst Gegenstand der Debatte sindВ».
Samuel Fitoussi. В«Ja, und das ist nicht nur theoretisch: Wenn Galileo Galilei heute leben wГјrde, wГјrde man ihn vielleicht als VerschwГ¶rungstheoretiker bezeichnen. Selbst das Gayssot-Gesetz in Frankreich, das die Leugnung des Holocaust verbietet, halte ich fГјr problematisch. Nicht weil ich den Holocaust leugne – natГјrlich nicht -, sondern weil es einen gefГӨhrlichen PrГӨzedenzfall schafft, wenn dem Staat die Macht gegeben wird, ein fГјr alle Mal zu entscheiden, was diskutiert werden darf und was nicht, selbst wenn es sich um eine etablierte historische Tatsache handelt. Eines Tages kГ¶nnte diese Macht dazu genutzt werden, die Infragestellung anderer sogenannter В«FaktenВ» zu verbieten – wie etwa die Vorstellung, dass der Westen В«systematischВ» rassistisch sei -, da sich immer eine sozialwissenschaftliche Studie finden lГӨsst, um dies zu rechtfertigen.В»
Das Interview erschien zuerst in franzГ¶sischer Sprache auf Le Regard libre, einer inspirierenden Medienplattform aus der Westschweiz. FГјr die deutsche Гңbersetzung war SICHTWEISENSCHWEIZ.CH besorgt. SICHTWEISENSCHWEIZ.CH dankt dem Team von Le Regard libre вҖ“ namentlich Jonas Follonier, Nicolas Jutzet und Yann Costa – fГјr die Zusammenarbeit.
KurzportrГӨt Samuel Fitoussi

Buchempfehlung
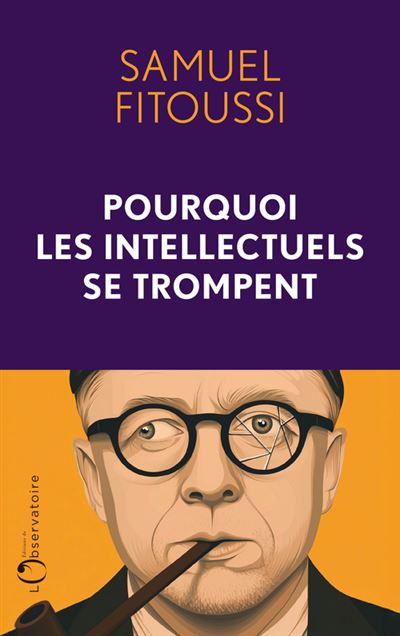
KurzportrГӨt des Interviewers Yann Costa

Medienempfehlung Le Regard libre






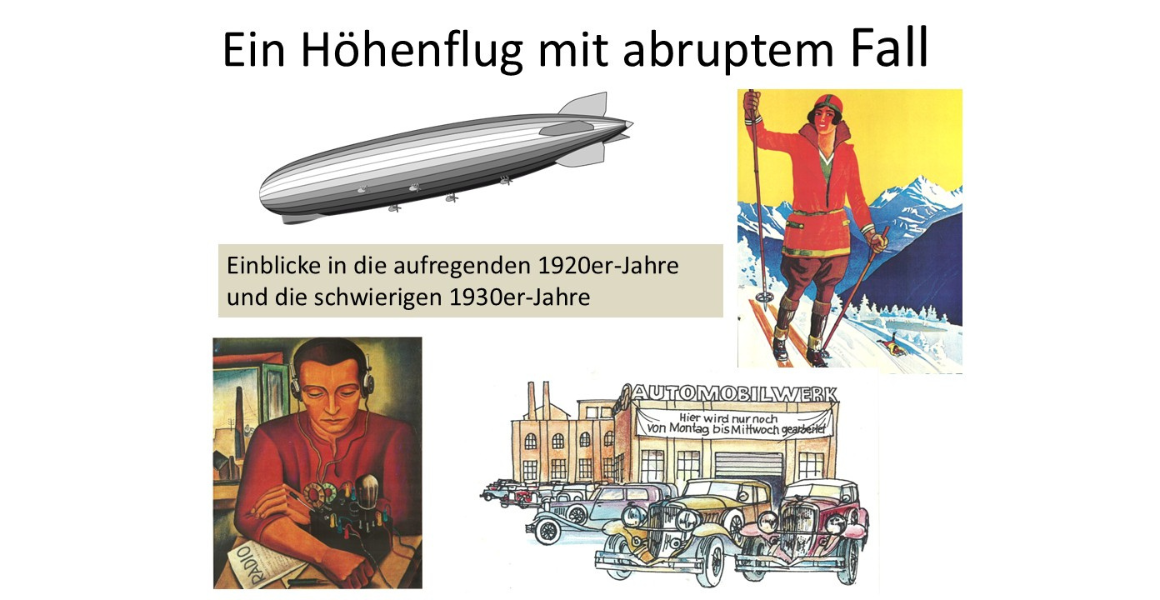


Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.