Remo Arpagaus ist Szenograf, Musiker und Chorleiter. Fû¥r die architektonische und bauliche Zukunft der Schweiz setzt er das unproduktive Land als neues Siedlungsgebiet in Szene: Leben, Wohnen und Arbeiten in alpinen DûÑrfern oder KleinstûÊdten, die sich an den Berg lehnen, deren Infrastruktur im Innern des Bergs ausgebaut wird ã mit herrlichem Panoramablick auf die renaturierten Talebenen.
Hier die 20 Gedanken und Anregungen sowie die eine Schlussbemerkung von Remo Arpagaus:
1. ô¨Wir mû¥ssen erkennen, dass wir in einer historisch einzigartigen Zeit leben. Unsere Ansprû¥che an persûÑnliche Freiheiten, Individualismus und damit an Konsum, MobilitûÊt und Raum sind geprûÊgt von nie dagewesenen grenzenlosen MûÑglichkeiten, aber auch von einem verschwenderischen, sorglosen Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfû¥gung stehen.ô£
2. ô¨Wir leisten uns den Luxus, dass wir unsere WohnhûÊuser, Fabriken, Schulen, Gymnasien und UniversitûÊten oder Bû¥rogebûÊude die HûÊlfte der Zeit leer stehen lassen.ô£
3. ô¨Wir betrachten MobilitûÊt als eine SelbstverstûÊndlichkeit, pendeln tûÊglich zur Arbeit oder reisen fû¥r eine Chorprobe von Zû¥rich nach Chur und zurû¥ck.ô£
4. ô¨Die BanalitûÊt, mit denen ein jeder heute die natû¥rlichen Ressourcen beansprucht, fû¥hrt auch auf Ebene der Gemeinde zu einem gedankenlosen Umgang mit dem Raum. Die Zersiedlung der Schweiz wird durch die Gemeindeautonomie gestû¥tzt, so dass der Individualismus selbst in der Gestaltung unserer Umwelt dominiert. Schweizer StûÊdte und DûÑrfer wachsen, oft von ûÑkonomischen Partikularinteressen getrieben, in die Landschaft hinein. Von aussen betrachtet, erscheint unser Siedlungsgebiet oft wie in ein strukturloses Konglomerat von HûÊusern und LeerrûÊumen. Vieles wurde und wird in der Schweiz ohne Konzept gebaut.ô£
5. ô¨Eine positive Bescheidenheit kûÑnnte zu neuen Einsichten fû¥hren. Denn die eben skizzierte Entwicklung ist nicht nur eine Folge von Fehlplanung oder falschen politischen Anreizen, sondern viel mehr eine gesellschaftliche und kulturelle Frage.ô£
6. ô¨Das Weltbild der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg ist tief geprûÊgt von Individualismus, Selbstverwirklichung und Eigenintentionen. Das Wirtschaftswachstum und die beinahe grenzenlose Verfû¥gbarkeit von Geld, Zeit und Energie haben unsere Erwartungen an diese geprûÊgt: Alles ist jederzeit und û¥berall verfû¥gbar.ô£
7. ô¨Wir mû¥ssen uns vor Augen halten, dass in den Berggebieten die Menschen in zwei bis drei Generationen aus einer Lebenswelt, die nûÊher am Mittelalter war als an unserer heutigen Welt, ins digitale Zeitalter katapultiert wurden. Meine Eltern halfen im Stall noch im Licht der Petrollampe, und die Kinder wurden schon mit vier Jahren auf das Feld geschickt. Vieles, was vor 70 Jahren selbstverstûÊndlich war, ist heute unvorstellbar.ô£
8. ô¨Weite Kreise in der Stadt- und LandbevûÑlkerung haben den wirklichen Bezug zu natû¥rlichen ZusammenhûÊngen verloren. Vergessen geht etwa, dass hinter jeder Pizza saftige Kornfelder, Grasweiden und Plantagen stecken. Milch stammt nicht aus dem Tetrapakbeutel, das Steak nicht aus der Xelofanfolie, sondern IMMER von einer Wiese!ô£
9. ô¨Der wirtschaftliche und der technologische Fortschritt hat unser Leben angenehmer, dynamischer, abwechslungsreicher und flexibler gemacht. Unbestritten ist, dass die Jahre des Wirtschaftsbooms unser Leben erleichtert haben.ô£
10. ô¨AuffûÊllig ist, dass die heutigen Zukunftsszenarien meist technologische Verheissungen sind, die – gefangen im Fortschrittsglauben – Individualismus und Selbstverwirklichung predigen.ô£
ô¨Warum nicht in den Alpen DûÑrfer und ganze KleinstûÊdte bauen,
Remo Arpagaus
die sich an den Berg lehnen?ô£
11. ô¨Fû¥r eine Schweiz im Einklang der Ressourcen braucht es eine andere, eine neue Generation, deren Mantra nicht immer mehr, immer hûÑher, immer besser, immer effizienter, immer schûÑner, immer raffinierter lautet.ô£
12. ô¨Meine Vorstellung besteht darin, die Alpen als ganzheitlichen Lebensraum wieder zu entdecken und im Einklang mit den Ressourcen zu bewohnen.ô£
13. ô¨Um so wenig Kulturland wie mûÑglich verschwenden zu mû¥ssen, wurden in den Alpen, und auch in anderen Gebieten, die Siedlungen fast ausschliesslich an der Peripherie des kultivierbaren Bodens angelegt. Beispiele gibt es zur Genû¥ge, hierzulande etwa im Wallis, Engadin oder Tessin, gar in alten Kulturen wie die Nilauen in ûgypten, um nur einige zu nennen. Die Gesellschaft muss neue Wege finden, um den Kulturboden in unserem Land zu schû¥tzen und intelligenter zu nutzen.ô£
14. ô¨In der Schweiz sind gemûÊss Bundesamt fû¥r Raumentwicklung nur etwa 43 Prozent der LandflûÊche fû¥r Siedlungen UND Landwirtschaft nutzbar, wûÊhrend 57 Prozent als unproduktives Land gelten.ô£
15. ô¨Heute leisten wir uns den Luxus, diesen knapper werdenden produktiven Boden immer mehr zu û¥berbauen. Daraus folgt meine Anregung an Fachpersonen aus Architektur und Landschaftsplanung sowie an Bauherrschaften und Politik: Das unproduktive Land sollte in der Schweiz als neues Siedlungsgebiet erschlossen werden.ô£
16. ô¨Die Vorstellung mag utopisch sein, aber warum nicht in den Alpen DûÑrfer und ganze KleinstûÊdte bauen, die sich an den Berg lehnen? Im Inneren des Bergs versteckt liegen die technische und energetische Infrastruktur, aber auch Lagerhallen, Urban-Farming-Anlagen, Sportstadien, Kino oder Theater kûÑnnten im Fels sein.ô£
17. ô¨Die futuristische Vision von einem Leben in der Vertikalen mit Terrassen, hûÊngenden GûÊrten, WasserfûÊllen sowie WohnhûÊusern, Schulen und Gewebebauten mit herrlichem Panoramablick auf die renaturierten Talebenen scheint lebensfremd und zu fantastisch. Aber schon die Inkas siedelten im peruanischen Hochgebirge, wo sie Terrassenlandwirtschaft pflegten und ein ausgeklû¥geltes BewûÊsserungssystem entwickelten, um in den wasserarmen Anden û¥berleben zu kûÑnnen.ô£
ô¨Zumindest fû¥r die Ressource Boden besteht die Hoffnung, dass eine nûÊchste Generation den Urplan der Besiedlung von Bergregionen wieder aufnimmt.ô£
Remo Arpagaus
18. ô¨Die Nutzung von unproduktivem Land als Siedlungsgebiet, seien es nun die Berge, sei es die Wû¥ste, sei es die Tundra oder seien es Sumpf- und Wasserlandschaften, beschûÊftigte die Menschheit schon immer. Die Geschichte zeigt, dass das Wohnen in extremen Regionen schon immer grosse Herausforderungen an die KreativitûÊt, die Zusammenarbeit und das soziale Zusammenleben der Menschen stellte, diese aber auch dazu motivierte, Einzigartiges zu erschaffen.ô£
19. ô¨Wenn sû¥deuropûÊische LûÊnder wie Griechenland, Italien oder Spanien mit kontinental-afrikanischen Temperaturen, die Schweiz ihrerseits zusehends mit sû¥deuropûÊischen Temperaturen û¥berzogen werden, erûÑffnen sich fû¥r die Menschen neue, lebenswertere Klimazonen in den Alpen mit gemûÊssigteren Temperaturen. Halten die hûÑheren Hitzegrade in tieferen Lagen langfristig an, kûÑnnte dies zu einer Flucht der BevûÑlkerung aus dem Unterland in die Berge fû¥hren. Das Unterland entsiedelt sich, der Dichtestress verringert sich. Die Nachfrage nach Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum in den Alpen steigt an.ô£
20. ô¨In diesem Wandel stelle ich mir Menschen vor, die zurû¥ck in die Berge ziehen ã nicht als Touristen oder Wochenendausflû¥gler, sondern um dort in einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und sozialen Gesellschaft zu leben und zu arbeiten, in enger Symbiose mit der Naturlandschaft, im Einklang mit den Ressourcen.ô£
20 plus 1: ô¨Erstmals formuliert habe ich einige der 20 Gedanken und Anregungen als TagtrûÊume der Architektur. Tage spûÊter, gewissermassen aus dem Tagtraum erwacht, wollte ich sie alle wegwerfen und fû¥r immer entsorgen. Gemach, halt, stop: Wegwerfen, zumal impulsgeleitet, wûÊre unbedacht. Denn in diesem Augenblick erinnerte ich mich an den ersten Gedanken. Wenn wir unsere Ressourcen schon sorglos wie nie zuvor verschwenden, so besteht hierzulande zumindest fû¥r die Ressource Boden die Hoffnung, dass eine nûÊchste Generation den Urplan der Besiedlung von Bergregionen als Grundprinzip wieder aufnimmt, das Kulturland als heilig/untouchable betrachtet und ausschliesslich unproduktive FlûÊchen in neue Siedlungsgebiete im Einklang mit den Ressourcen erschliesst. Und sollte Kulturland ausnahmsweise bebaut werden mû¥ssen, so muss das bebaute Kulturland um die doppelte FlûÊche kompensiert werden ã entweder durch bestehende Bauten auf ehemaligem Kulturland oder durch neue Bauten auf den fû¥r Anbau- oder WeideflûÊchen ungeeigneten und unfruchtbaren Berggebieten.ô£
KurzportrûÊt Remo Arpagaus

TagtrûÊume der Architektur
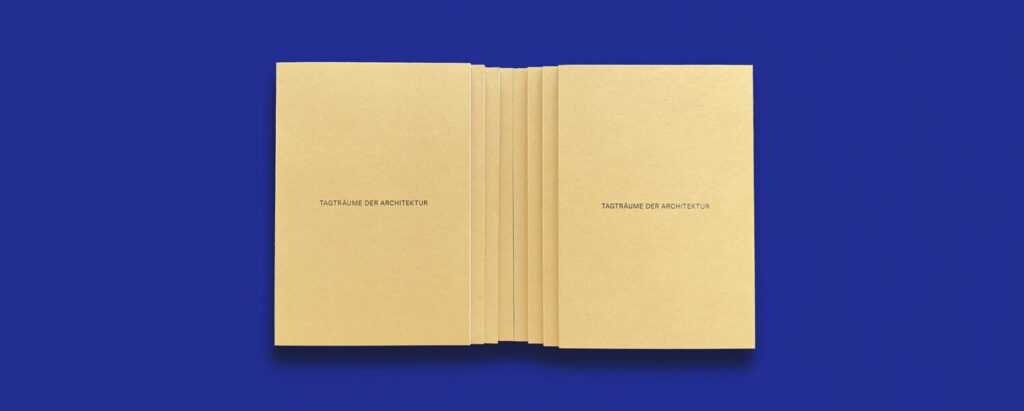
Bildnachweis: Titelbild Leander Wenger / Zermatt Tourismus, PortrûÊtbild Barbara Truog








Es wurde noch kein Kommentar verûÑffentlicht.