Regula Kaiser, Leiterin der Fachstelle Stadtentwicklung und Stadtmarketing der Stadt Zug, entwickelt im GesprÃĪch mit Autor Werner Schaeppi familienfreundliche Ideen fÞr die Stadt der Zukunft.
Herausgefordert sind Architektur und Investoren, Bewohnerschaft und BehÃķrden. GestÃĪrkt werden Wohn- und LebensqualitÃĪt, Gemeinwohl und BÞrgersinn.
Stadtentwicklerin Regula Kaiser wÞnscht sich eine familienfreundliche UrbanitÃĪt. Die Stadt der Zukunft soll zeitgemÃĪss dicht und gleichzeitig lebenswert sein, indem sie sich auf die BedÞrfnisse und wechselnden Lebenssituationen der Bewohnerinnen und Bewohner ausrichtet. Chancen dafÞr sieht sie in der Gestaltung von GebÃĪuden und AussenrÃĪumen, aber auch im Prinzip der Sharing Economy und im Mut zur Gemeinsamkeit.
ÂŦWir sollten unsere AnsprÞche an das Hausinnere reduzieren und dafÞr dem Aussenraum und der Bereitstellung gemeinsam nutzbarer Ressourcen mehr Bedeutung geben. Dadurch fÃķrdern wir die AufenthaltsqualitÃĪt und das Zusammenleben im urbanen Raum.Âŧ Bei der gedanklichen Umsetzung ihrer Vision setzt Regula Kaiser pragmatisch bei der Architektur von HochhÃĪusern und der Weiterentwicklung der klassischen Blockrandbebauung an. ÂŦMit beiden Siedlungsformen lÃĪsst sich im urbanen Raum eine hohe Dichte erzeugen, und bei beiden ist das Potenzial in Richtung Familienfreundlichkeit heute noch bei weitem nicht ausgeschÃķpft.Âŧ
Lebensfreundlich planen und gestalten
Durch zeitgemÃĪsse GebÃĪude- und Arealstrukturen sollen die urbanen Zentren insgesamt freundlicher und lebenswerter werden. Eine Voraussetzung ist laut Kaiser, dass sowohl innerhalb von GebÃĪudekomplexen und Siedlungen als auch im umgebenden Freiraum unterschiedliche Belegungsdichten und Grade der Ãffentlichkeit mÃķglich sind.
ÂŦAls Erstes kÃķnnen wir HochhÃĪuser und Blockrandbebauung so gestalten, dass Kinder eine Bandbreite an RÃĪumen und Infrastrukturen vorfinden, die den unterschiedlichen BedÞrfnissen der Entwicklungsstufen gerecht werdenÂŧ, erklÃĪrt Kaiser. Es sollen FreirÃĪume geschaffen werden, die es den Kindern ermÃķglichen, sich altersgerecht zu betÃĪtigen und zu entfalten. In HochhÃĪusern wÃĪre beispielsweise ein halbÃķffentlich zugÃĪngliches Zwischengeschoss nÞtzlich, das als Treffpunkt fÞr die Bewohnerschaft fungiert und in dem sich die Kinder entfalten kÃķnnen. ÂŦDie Kinder halten sich zu Beginn der Entwicklung vielleicht noch viel in der Wohnung auf. In einer spÃĪteren Phase treffen sie sich im Hof oder im Zwischengeschoss des GebÃĪudes, und je ÃĪlter sie werden, desto interessanter werden die umgebende Natur, der Jugendtreffpunkt oder die Begegnungen in der Stadt. Wenn die Architektur kindergerecht ist, dann erleichtert das auch die Arbeit der Betreuungsperson und fÃķrdert damit die AufenthaltsqualitÃĪt fÞr Familien.Âŧ
Ein willkommener Nebeneffekt: Indem man konsequent geeigneten Freiraum fÞr die Entfaltung der Kinder und ihrer Familien schafft, verringert sich der Anspruch an die Wohnung selbst. ÂŦWenn genÞgend attraktive FreirÃĪume sowie eine allgemein zugÃĪngliche Infrastruktur zur VerfÞgung stehen, kommen Familien mit kleineren und erschwinglicheren Wohnungen ausÂŧ, meint Regula Kaiser. Entlastend wirken zum Beispiel ein zentraler Stauraum, wo die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft selten Gebrauchtes zwischenlagern â vielleicht sogar ausleihen â kÃķnnen, eine kleine Werkstatt oder etwa ein zentral gelegenes GÃĪstezimmer, das man bei Bedarf temporÃĪr zumieten kann. ÂŦSolche Angebote reduzieren den Platzbedarf in der Wohnung und ermÃķglichen es unter UmstÃĪnden sogar, auf ein drittes oder viertes Zimmer zu verzichten.Âŧ Und schliesslich mÞssen die einzelnen GebÃĪude, Siedlungen und Quartiere laut Kaiser auch auf raumplanerischer Ebene durch Wege, Strassen und zusammenhÃĪngende AussenrÃĪume vernetzt werden. ÂŦSo entsteht stÃĪdtebauliche QualitÃĪt.Âŧ

Gemeinschaft leben
Zur FÃķrderung der Aufenthalts- und LebensqualitÃĪt sollen kÞnftige Siedlungen, GebÃĪude und AussenrÃĪume gezielt Infrastruktur zur gemeinsamen Nutzung zur VerfÞgung stellen, von GartensitzplÃĪtzen Þber Grillstellen und SpielplÃĪtze bis zur GemÞse-AnbauflÃĪche. ÂŦUnd eigentlich wÃĪre auch in jedem grÃķsseren Mehrfamilienhaus ein MobilitÃĪts-Hub im Untergeschoss zu erwartenÂŧ, meint Kaiser, ÂŦmit diversen Fahrzeugen, die den Bewohnern zur VerfÞgung stehen, sodass sich individuelle Fahrzeuge erÞbrigen.Âŧ Weiter kÃķnnte das Angebot auch ein Magazin mit GerÃĪten und Utensilien vom Staubsauger Þber Werkzeuge bis zum Kuchenblech umfassen, welche der Bewohnerschaft bei Bedarf zur VerfÞgung stehen, sodass sie nicht jeder Haushalt fÞr sich anschaffen und aufbewahren muss.
ÂŦKonfliktfreies Leben ist langweilig. Unsere Architektur ist heute viel zu stark darauf ausgerichtet, Konflikte zugunsten von AnonymitÃĪt zu vermeiden.Âŧ
Regula Kaiser, Stadtentwicklerin
Das Teilen von Ressourcen fÃķrdert die Gemeinschaft, birgt aber auch Konfliktpotenzial. Regula Kaiser sieht das keineswegs negativ: ÂŦKonfliktfreies Leben ist langweilig. Unsere Architektur ist heute viel zu stark darauf ausgerichtet, Konflikte auf Kosten des gemeinschaftlichen Erlebnisses und zugunsten von AnonymitÃĪt zu vermeiden. In einer lebendigen Wohnumgebung dÞrfen ruhig auch mal Wasser, Sand, Dreck und der LÃĪrm des Spielens vorkommen.Âŧ
Konfliktmanagement ist laut Kaiser ein inhÃĪrenter und formender Teil des Zusammenlebens. ÂŦNachbarschaftliches Zusammenleben entsteht, indem man Reibung hat und LÃķsungen miteinander findet.Âŧ Die breite Akzeptanz und VerfÞgbarkeit elektronischer Kommunikationsmittel wie Nachbarschafts-Apps und WhatsApp-Gruppen begÞnstigt diesen Prozess. ÂŦSo sollte beispielsweise in jedem Mehrfamilienhaus ein Mieter-Chat fÞr den kontinuierlichen Austausch in der Bewohnerschaft und die rasche Integration von Neumieterinnen und -mietern zur VerfÞgung stehen.Âŧ
SelbstverstÃĪndlich ist all dies auch mit Aufwand verbunden. ÂŦGemeinschaft ist nicht gratis, man muss sich das etwas kosten lassenÂŧ, meint Regula Kaiser. Das betrifft nicht nur die Anschaffung und Bereitstellung geeigneter RÃĪume, Ressourcen und Strukturen, sondern auch den Betrieb und Unterhalt. ÂŦEs muss jemand zustÃĪndig sein. Vielleicht ist es der Hausdienst oder jemand aus der Bewohnerschaft, der zu den RÃĪumlichkeiten.Âŧ
Es ist denkbar, dass fÞr die lebenswerte Stadt der Zukunft auch BehÃķrden einen Teil ihrer Handlungen, Usanzen und Vorschriften neu Þberdenken mÞssen, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Ãķffentlichen RÃĪume. ÂŦHeute ist im Ãķffentlichen Raum fast alles geregelt oder untersagt. Im Gegenzug muss mit Ãķffentlichen Mitteln das Stadtleben gefÃķrdert werden. Ein bisschen mehr Laisser-faire wÞrde unserem Stadtleben manchmal ganz guttunÂŧ, meint Regula Kaiser. Voraussetzung fÞr die lebenswerte Stadt der Zukunft sind der Mut und die Bereitschaft aller Beteiligten, sich den Herausforderungen des Zusammenlebens in zunehmend engerem Raum zu stellen und diese als Chance zu begreifen.
KurzportrÃĪt Regula Kaiser

KurzportrÃĪt Werner Schaeppi
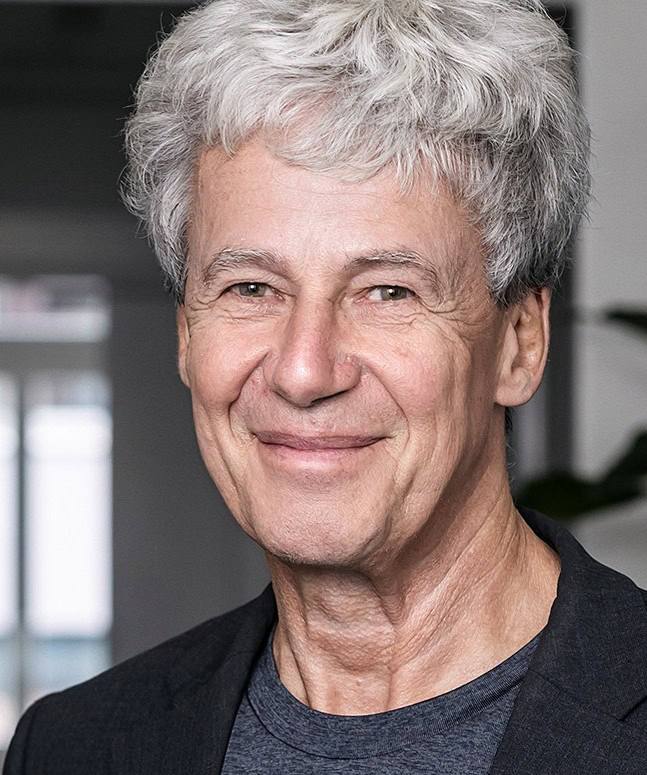
Buchempfehlung ÂŦTagtrÃĪume der ArchitekturÂŧ
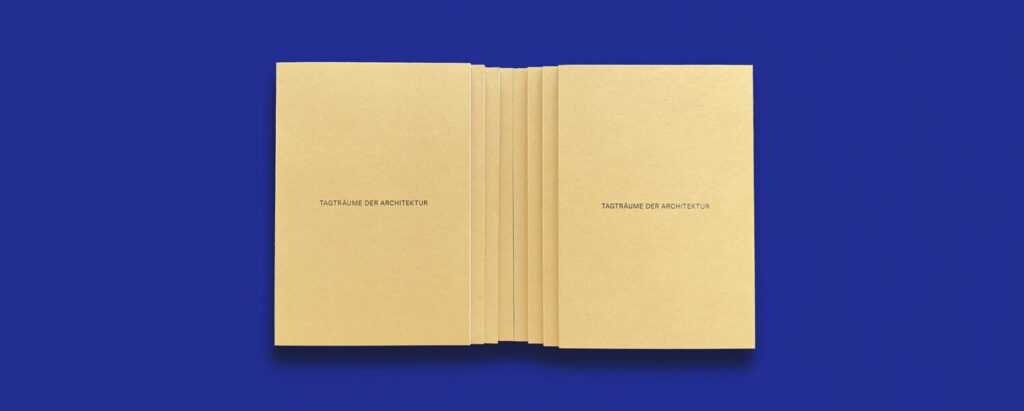
Bildnachweis: Stadt Zug / Alexandra Wey








Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.