Der Historiker Benedikt Meyer beleuchtet die UrsprÞnge des Fahrradfahrens, seine BlÞtezeit zur Jahrhundertwende, seine AlltÃĪglichkeit in der Zwischenkriegszeit, sein Verschwinden im Rahmen der Motorisierung und seine unerwartete Renaissance seit 1970.
Sein Buch ÂŦvorwÃĪrts rÞckwÃĪrtsÂŧ ist eine spannende Entdeckungsreise in wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Hinsicht. Die Geschichte des Fahrradfahrens in der Schweiz ist gewiss fÞr alle ÂŦGÞmmelerÂŧ und darÞber hinaus fÞr alle Velofahrerinnen und -fahrer ein Muss â und ein Geschenk.
Und wo startet die ÂŦhistorische VelotourÂŧ mit Benedikt Meyer? In âĶ China. Mit einem Amerikaner.
Made in China: Die USA ein Fahrradland?
1975 macht der oberste US-Diplomat in China eine erstaunliche Aussage: ÂŦJe mehr ich Þber die Transportprobleme in unserem Land nachdenkeÂŧ, erklÃĪrte George Herbert Bush, ÂŦdesto mehr erkenne ich eine wichtige Rolle fÞr das Fahrrad im amerikanischen Leben. (âĶ) Nachdem ich in China selbst viel Fahrrad gefahren bin, bin ich Þberzeugt, dass es sich dabei um ein Verkehrsmittel handelt, das zugleich praktisch, Ãķkonomisch, sauber und ÃĪusserst sinnvoll ist.Âŧ Das Fahrrad als Vision fÞr Amerika? Ein GefÃĪhrt von gestern fÞr die Zukunft? Low-Tech fÞr die High-Tech-Nation? Das kommunistische China als Modell fÞr die Supermacht des Westens?
Dass Fortschritt stets eine Frage des Standpunkts ist, illustrieren gemÃĪss Buchautor Benedikt Meyer die Debatten ums Fahrrad auch hierzulande ideal:
- Mal schien das Fahrrad veraltet, dann zukunftsweisend.
- Mal etwas fÞr Ewiggestrige, dann fÞr die Avantgarde.
- Mal als Zeichen des Fortschritts, mal als RÞckschritt.
- Mal galt es als progressiv, mal als nostalgisch.
- Und nicht selten war es alles zusammen.
Querelen ums Fahrrad gab und gibt es immer wieder, wenn auch unter wechselnden – wirtschaftlichen, sozialen, umweltbezogenen, technischen – Vorzeichen. Daraus zieht Benedikt Meyer die redliche – oder hier wohl eher zweirÃĪdliche – Quintessenz: ÂŦIm Auf und Ab seiner Geschichte spiegeln sich Utopien, Ideale und simple Notwendigkeiten.Âŧ
VelobestÃĪnde in der Schweiz – rauf, runter und wieder rauf
Zur Klarstellung: In der gesellschaftlichen wachstumsorientierten MobilitÃĪtsentwicklung ist die Fahrradgeschichte nur ein Seismograph, allerdings ein erhellender und erkenntnisreicher in verschiedener Hinsicht.
Wer in der Schweiz mit dem Velo unterwegs ist, kennt das Rauf und Runter und wieder Rauf. Das gilt auch fÞr die statistische Entwicklung der VelobestÃĪnde in der Schweiz.
| Jahr | Velobestand in der Schweiz pro 1000 Einwohner und Einwohnerinnen | Velostatistische Bewegung |
| 1910 | 120 FahrrÃĪder | Anstieg |
| 1952 | 386 FahrrÃĪder | VorlÃĪufiger Peak |
| 1971 | 206 FahrrÃĪder | Abstieg |
| 1996 | 522 FahrrÃĪder | Anstieg |
| 2025 | 733 FahrrÃĪder | Anstieg |
GemÃĪss Velosuisse liegt der aktuelle Velobestand in der Schweiz bei rund 5,2 Millionen, derjenige der E-Bikes bei 1,4 Millionen, per 2025 zusammengerechnet also rund 6.6 Millionen Velos auf rund 9 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, also 733 Velos pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Stastiken illustrieren den Anstieg, RÞckgang und Wiederanstieg der Velos pro Kopf der BevÃķlkerung. Und sie verschweigen, ÂŦwie die RÃĪder genutzt werden, von wem, wozu oder welchen gesellschaftlichen Status das Rad innehatte.Âŧ
Die Fahrradgeschichte 1816-1910 beginnt mit einem Knall
Die Geschichte, so Benedikt Meyer, beginnt mit einem Knall. Im April 1815 brach auf der indonesischen Insel Sumbawa der Tambora-Vulkan aus. Die Auswirkungen waren bis nach Europa spÞrbar:
- 1816 fiel der Sommer aus. Chronisten sprachen von einem ÂŦSchneesommerjahrÂŧ.
- Missernten, HungersnÃķte, Unruhen folgten.
- Vielerorts verendete das Vieh.
- Namentlich Pferde konnten nicht mehr ernÃĪhrt werden.
- Der Haferpreis stieg massiv an.
- In der Schweiz wurde der Notstand ausgerufen.
Diese einschneidende Wirtschafts-, Umwelt und Gesellschaftskrise veranlasste 1817 den deutschen Karl Freiherr von Drais, ein Forstaufseher und TÞftler, zur Entwicklung einer zweirÃĪdigen Laufmaschine, angetrieben mit Menschen- statt mit Pferdekraft. Die gesellschaftliche Wirkung seiner bekannten Draisine war begrenzt.
Als ÂŦDandy-HorseÂŧ blieb die Draisine ein spleeniges Spielzeug fÞr exzentrische Adlige. Es dauerte nochmals fast fÞnfzig Jahre, bis aus dem Laufrad ein Fahrrad wurde.
Erst 1861 wurden der Maschine in der Werkstatt des Pariser Schmieds Pierre Michaux an der Vorderradnabe befestigte Pedale eingefÞgt. Michaud konnte die Nachfrage fÞr das Fahrrad kaum decken.
In Paris, der ÂŦCapitale du 19ÃĻme SiÃĻcleÂŧ frÃķnten Adel, Geldadel und Intelligenzija als Vorreiter dem kapriziÃķsen Fahrradsport.
Das Fahrradgewerbe mutierte vom TÞftlermetier zur Leitindustrie. Fortschritte in der Fahrradtechnik und -nutzung standen im Wechselspiel: ÂŦZwischen 1820 und 1890 gewann das Rad beeindruckende 0.5m/s je Dekade an Geschwindigkeit, verlor an Gewicht und steigerte die Effizienz der KraftÞbertragung.Âŧ
Um 1890 war das Fahrrad soweit, dass es Zugang zu einer grÃķsseren KÃĪuferschicht fand: Es war leicht und pannenarm. Herstellung und Handel begannen zu boomen. In den Jahren zwischen 1890 und 1910 entfaltete das Rad grÃķsste soziale Strahlkraft: Veloclubs, Velozeitungen, Velorennen, Velomode, VeloverbÃĪnde, Velofahrschulen, Veloromane, Veloplakate prÃĪgten den gesellschaftlichen Aufstieg des Fahrrads.
Erst die Verbreitung des Fahrrads erlaubte grÃķssere Distanzen zwischen Arbeits- und WohnstÃĪtten. Insbesondere die Emanzipation der Frauen kam voran. Radlerinnen tauschten Rock gegen Hose.
Fahrradfahren 1910-1945: Vom Luxusgut zum Alltagsvehikel
Etwa um 1910 war der Hype vorbei. Mit der Popularisierung ging eine Proletarisierung einher. Die Industrie musste sich anpassen – von der Fertigung eines Luxusgutes zur Produktion eines Gebrauchsgegensandes. Das rÞttelte, wie Benedikt Meyer prÃĪgnant feststellt, die Branche zunÃĪchst durch: ÂŦDas Fahrrad verlor an Glanz, Preis und Prestige.Âŧ
Die Industrie suchte nach neuen Wegen. Und fand sie. So ÃĪnderte sich noch vor dem Ersten Weltkrieg das GefÃĪhrt technisch. Separate Bremse, Gangschaltung und geschwungener Lenker machten das Fahrrad stadttauglicher und gemÞtlicher.
Das Fahrrad wurde fÞr Angestellte und Arbeiter erschwinglich. Das Rad wurde zum Alltagsgut. Die Gesellschaft als ganze wurde mobiler, …
- was in den StÃĪdten den Bau von Aussenquartieren ermÃķglichte,
- was die Mieten sinken liess,
- was die Wohnsituation der stÃĪdtischen BevÃķlkerung verbesserte.
Das ehemalige adlige ÂŦDandy-HorseÂŧ wurde zum Drahtesel der arbeitenden Klasse. Doch was alle hatten, war nicht mehr fÞr alle attraktiv. Fortschritt und Fahrrad gingen kÞnftig getrennte Wege. Bereits 1920 stand das Automobil vor einer ersten â auf die Oberschichte begrenzten â Popularisierungswelle.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sank die Zahl der Privatwagen auf das Niveau von 1922, gleichzeitig konnte das Fahrrad erst noch leicht zulegen, um dann infolge des Kautschukmangels zu stagnieren. Mehr als jeder Dritte besass nun ein Rad. Und in ZÞrich und St. Gallen traten ernsthafte Parkplatzprobleme auf – fÞr Velos.
Zugleich kamen zahlreiche MÃĪnner dank der Armee erstmals in Kontakt mit Lastwagen und Autos, eine Erfahrung, welche den Durchbruch der Motorfahrzeuge in den Nachriegsjahren begÞnstigte.
Fahrradfahren 1945-1968: Vom Zenit zur Randnotiz
Obschon 1952 das Velo in der Schweiz mit 386 Velos pro 1000 Einwohner einen vorlÃĪufigen Zenit erreichte, wurden im Zuge einer stÞrmischen Motorisierung die Velofahrer zusehends zur QuantitÃĐ NÃĐgligeable.
Radfahrer und Radwege verschwanden aus dem Strassenbild. ÂŦEin Prozess, der schleichend verlief, mit wenig Gegenwehr und gewÃķhnlich kaum bemerkt wurdeÂŧ, stellt Benedikt Meyer fest. Pointiert formuliert: Der Bau von Radwegen wurde hierzulande so lange verschlafen, bis er nicht mehr nÃķtig war.
Denn mit dem Aufkommen der Autos und der ErÃķffnung von Autobahnen ab 1955 wurde das Land und die Landschaft neu hergerichtet. Die Schweiz wurde nicht kleiner, sie war nur schneller erreichbar. Auch die StÃĪdte verÃĪnderten sich: Vororte verschmolzen, Agglomerationen entstanden, Garagen sprossen hervor, in den Bergen wurden Zweitwohnungen errichtet.
Das Fahrradgewerbe in der Schweiz verfiel in einen DornrÃķschenschlaf.
Mit dem Verschwinden des Velos aus dem Alltag verschwanden auch deren Lobbyisten. Auch der Fahrradhandel hatte in der Nachkriegszeit ein Problem: die Nachfrage schwand. Zwar wurden KinderrÃĪder verstÃĪrkt nachgefragt, solche fÞr Erwachsene wurden immer weniger gekauft.
DÞster prÃĪsentierte sich die Lage auch fÞr die Hersteller von Velos. Die UmsÃĪtze waren rÞcklÃĪufig, die Zukunftsaussichten angesichts der Wachstumsraten der Autos trostlos. Investitionen und Innovationen wie das ÂŦPfiffÂŧ-Klapprad 1960 fanden kein Publikum. Im schrumpfenden FahrradgeschÃĪft wurde der Konkurrenzkampf Þber Details wie Farben und Lackierungen ausgetragen.
Der Gesetzgeber schenkte dem Fahrrad in den 1960er-Jahren wenig Beachtung. Einzig ein Obligatorium fÞr RÞcklichter wurde 1966 eingefÞhrt.
Bei der Verbreitung und Verwendung des Velos in der Schweiz weist Benedikt Meyer auf regionale Unterschiede hin: ÂŦBis zum Ersten Weltkrieg waren Velos in der Romandie verbreiteter als in der Deutschschweiz. Dann entwickelte sich das Radfahren in der Deutschschweiz dynamischer und nach dem Zweiten Weltkrieg brachen die BestÃĪnde in den lateinschen Kantonen noch dramatischer ein als chez les alÃĐmaniques.Âŧ Selbst in den (steilen) Bergkantonen gingen die VelobestÃĪnde gar weniger stark zurÞck als in Genf.
Fahrradfahren 1968-1973: Bewegung und Stillstand im Fahrradmarkt
LÃĪrm, Luftverschmutzung, Energieverbrauch, Verkehrsopfer, Staus, Wachstumskritik, LebensqualitÃĪt fÞhrten zu einer aufkeimenden Kritik der 1968er-Generation am automobilen Strassenverkehr. Vermeintlich wÞrde dadurch einiges fÞrs Fahrrad sprechen. WÞrde. Was wirklich zÃĪhlt, bringt Historiker Meyer auf den Punkt: ÂŦDas Problem war, dass das Rad gar nicht mehr als Verkehrsmittel angesehen wurde, geschweige denn als LÃķsung fÞr die Verkehrsprobleme.Âŧ
FÞr die Wende der Jahre 1968 bis 1973 greift die Situation auf den Strassen zu kurz. Entscheidend waren weniger die Staus, als vielmehr eine Faszination, fÞr die das Fahrrad wieder neue Hoffnungen ermÃķglichte: dem Umweltbewusstsein und der Kritik an Fortschritts- und Wachstumsdenken. Die Sympathisanten dieser Bewegung in den frÞhen 1970er-Jahren waren ausserordentlich vielfÃĪltig:
- rational oder emotional,
- politisch rechts oder links,
- zukunftsgerichtet oder rÞckwÃĪrtsgewandt.
Aber auch alltÃĪgliche EinflussgrÃķssen begÞnstigten den erneuten Aufschwung, wie Benedikt Meyer treffend analysiert: ÂŦIn den 1970-er-Jahren war das Fahrradfahren auch ein Mittel, um seinen Nonkonformismus und seine AufgeklÃĪrtheit zu demonstrieren. Radfahrer waren – fÞr alle sichtbar – unabhÃĪngig und flexibel, umweltfreundlich, individuell, spontan und Herren und Damen ihres Fahrzeugs und ihrer Zeit. Parkplatzsuche, Staus und Benzinpreise kÞmmerten sie nicht.Âŧ
Fazit: Der Umbruch 1968 bis 1973 war Bewegung und Stillstand zugleich. Gebrauch und Wahrnehmung ÃĪnderten sich, die BestÃĪnde und der Absatz aber stagnierten.
Fahrradfahren 1973-1980: Das Velo wird erwachsen
1973 drosselten die OPEC-Staaten die FÃķrderung des ErdÃķls. Zwischen 1973 und 1974 stieg der Ãlpreis von 3 bis zu 12 Dollar pro Barrel.
Zudem kollabierte 1973 das System der stabilen Wechselkurse zwischen den westlichen IndustrielÃĪndern.
Beides zusammen bewirkte eine deutliche AbkÞhlung der Konjunktur und das Ende der wirtschaftlichen Boomphase der Jahre nach dem Zeiten Weltkrieg.
Das Benzin wurde massiv teurer, im Winter 1973/1974 wurden in der Schweiz drei Sonntage fÞr autofrei erklÃĪrt. Der Effekt aufs Fahrrad war unmittelbar. Die Hersteller und HÃĪndler verzeichneten Zuwachsraten im Absatz. Indes ist das Umsatzplus des Fachhandels ein Nebenschauplatz, wie Benedikt Meyer treffend erlÃĪutert: ÂŦWichtiger war das neue Publikum: Leute, die seit ihrer Kindheit nicht mehr Fahrrad gefahren waren, fanden zurÞck in den Sattel – und daran Gefallen.Âŧ
ÂŦLeute, die seit ihrer Kindheit nicht mehr Fahrrad gefahren waren,
Benedikt Meyer, Historiker und Buchautor
fanden zurÞck in den Sattel – und daran Gefallen.Âŧ
GemÃĪss Benedikt Meyer hÃĪlt die Geschichte des Fahrrads die eine nicht unerhebliche Lektion fÞr Marketingprofis bereit: ÂŦDas Velo gewann Kundschaft, die es ohne Ãlkrise auch mit erheblicher Werbung kaum erreicht hÃĪtte. Die Ãlkrise verÃĪnderte ausserdem die Wahrnehmung: Das Auto stand neuerdings fÞr AbhÃĪngigkeit, das Fahrrad fÞr UnabhÃĪngigkeit.Âŧ
Die neue Kundschaft entdeckte das Fahrrad nicht nur als Sport- und Spassvehikel, sondern als MÃķglichkeit, sich im Alltag mehr und damit gesundheitsfÃķrdernd zu bewegen, indem sie etwa den Arbeitsweg oder die EinkÃĪufe auf zwei RÃĪdern absolvierte.
In den 70ern erschloss das Rad neue Kundengruppen – diese waren ÃĪlter, mit hÃķherer Kaufkraft ausgestattet, gebildet, umweltbewusst und fragten vermehrt sportliche und teurere Modelle nach. Vermehrt setzten die Hersteller auf technisch hochwertige Modelle.
Ein anderer PopularitÃĪtsbeweis zeigte sich auf der Strasse: Mitte der 1970er-Jahre ging es mit den Velo-DiebstÃĪhlen wieder bergauf. Endlich, wÞrden sich wohl ÂŦVelofundisÂŧ nicht verkneifen kÃķnnen.
Auch Þber Radwege wurde nun wieder verstÃĪrkt diskutiert. Dabei ging es ab Mitte der 1970er-Jahre um zusammenhÃĪngende Netze, die zunÃĪchst im Umfeld vor Schulen, spÃĪter im Stadtgebiet gebaut werden sollten.
Fahrradfahren 1980-2008: GefÃĪllige Neuerungen, neue GeschÃĪftsmodelle
1971 kamen auf 1000 Menschen in der Schweiz 206 FahrrÃĪder. 1996 waren es 522. Das Velo feiert seine Renaissance – politisch, technologisch und wirtschaftlich.
Die Radfahrer gewannen an politischer PrÃĪsenz. Die FÃķrderung der Fahrradnutzung wurde fortgesetzt. Die Verkehrsinfrastruktur wurde vielfÃĪltiger und fahrradfreundlicher ausgestaltet. Dabei ging es um grosse Projekte und tausende kleiner Details: Vortrittsrechte, Kanalisationsdeckel, Einbahnstrassen, BrÞcken, Spiegel, Signalemente, Ampeln, Radstreifen, ParkplÃĪtze, Radwegnetze, Tempolimiten, Kombinierbarkeit des Fahrrades mit dem Ãffentlichen Verkehr, Fahrradverleih, um nur einige zu nennen. PopulÃĪr ist das landesweite Projekt ÂŦVeloland SchweizÂŧ.
Zugleich konnten die Hersteller mit zahlreichen gefÃĪlligen Neuerungen aufwarten. Mountainbikes und E-Bikes schafften den Wandel vom industriellen Massenprodukt zum individuellen Lifestyle-Brand, mit dem sich fortan Abenteuerlust, Naturverbundenheit, Umweltschutz oder Fitnesskult verbinden liessen.
Neue GeschÃĪftsmodelle entstanden, indem etwa Fahrradkuriere eine ausdifferenzierte Kundschaft bedarfs- und zeitgerecht bedienen.
Fahrradfahren 2008 bis heute: Interview mit Buchautor Benedikt Meyer
2008 schliesst Benedikt Meyer seine Forschungsarbeit zur Geschichte des Fahrrads in der Schweiz mit folgendem Ausblick: ÂŦDas Fahrrad hat noch offenes Potenzial. Wenn dieses genutzt werden soll, kann es nicht schaden, es wieder einmal neu zu erfinden.Âŧ
2008 war, 2025 ist. SICHTWEISENSCHWEIZ.CH hat bei Benedikt Meyer nachgefragt, wie er die jÞngste Geschichte des Fahrradfahrens zwischen 2008 und heute in der Schweiz einschÃĪtzt.
Wie hat sich die Situation seit 2008 weiterentwickelt?
Benedikt Meyer: ÂŦDie grÃķsste VerÃĪnderung sind die E-Bikes. Ihre Zahl hat seit 2008 massiv zugenommen. Damit verÃĪndert sich die Nutzerschaft des Velos, indem ÃĪltere Leute lÃĪnger aktiv bleiben, aber auch die Nutzungsweise, indem etwa lÃĪngere Strecken zurÞckgelegt oder aber auch grÃķssere Lasten transportiert werden. Man denke nur etwa an die Kistenvelos, mit denen von Kindern bis Zimmerpalmen alles MÃķgliche herumgefahren wird.Âŧ
Und wie sieht die Zukunft aus?
Benedikt Meyer: ÂŦDas weiss ich natÞrlich nicht. Aber ich beobachte, dass es in den letzten Jahren auf den Fahrradspuren chaotischer geworden ist. Es sind alle mÃķglichen Velotypen unterwegs, dazu 25er- und 40er-E-Bikes, E-Roller, E-Trottinette, Lastenvelos und, und, und. Alle haben unterschiedliche Dimensionen, Kurvenradien, Bremswege und Beschleunigungsverhalten. Das erfordert viel gegenseitige RÞcksichtnahme. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt!Âŧ
Wenn Sie mit einer Massnahme den Veloverkehr fÃķrdern mÞssten, welche wÃĪre das?
Benedikt Meyer: ÂŦNehmen wir etwas, das einfach und billig ist: Vortrittsregeln und Farbe. In meiner Nachbarschaft gibt es eine Veloroute durch die Agglomeration. Sie fÞhrt abseits der grossen Strassen der Talachse entlang durch die Wohnquartiere. Ãberall gilt Tempo 30, Þberall gilt Rechtsvortritt. In Gemeinde A hat die Veloroute neu Vortritt und ist zudem rot markiert. Es ist krass, was das fÞr einen Unterschied macht! Man kann es einfach rollen lassen und muss nicht jedes Mal ÂŦspienzelnÂŧ, ob nicht vielleicht ausnahmsweise doch jemand von rechts kommt. Dann kommt man in Gemeinde B und es ist wieder kompliziert.Âŧ
Was halten Sie von einer Velosteuer, wie sie aktuell diskutiert wird? Oder von einer Helmpflicht?
Benedikt Meyer: ÂŦIch bin nicht aus Prinzip gegen eine Steuer. Aber wer etwas bezahlt, hat Anrecht auf eine Gegenleistung. Da bin ich gespannt, was die Initianten vorschlagen âĶ .
Helme sind toll, eine Pflicht sehe ich aber kritisch. DafÞr sollte endlich ein Verbot von KopfhÃķrern durchgesetzt werden. Wer so unterwegs ist, dem ist echt nicht zu helfen. Auch ein Licht gehÃķrt ganz einfach ans Velo. Da habe ich selbst schon Leute fast Þberfahren.Âŧ
Und was fÞr einen Flitzer fahren Sie selbst?
Benedikt Meyer: ÂŦIch habe ein 13jÃĪhriges, 25 Kilo schweres Tourenvelo. Das hat bislang noch jeden Pass geschafft. Zur Hochzeit haben meine Frau und ich zudem ein Tandem geschenkt bekommen. Eines, bei dem der vordere Teil wie ein Liegevelo gebaut ist. Man ist zusammen unterwegs und beide sehen etwas. Eine grossartige Erfindung!Âŧ
SICHTWEISENSCHWEIZ.CH dankt Beneditk Meyer fÞr das Interview.
KurzportrÃĪt Benedikt Meyer

Buchempfehlung
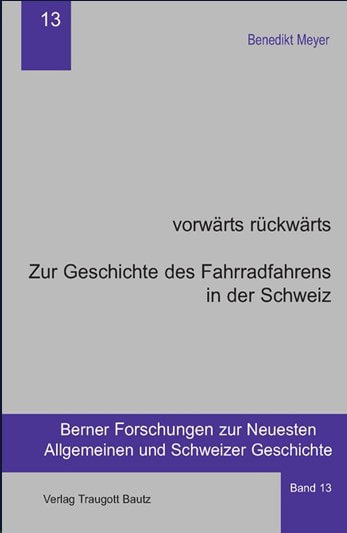
Dominik Thali, Der Velofahrer, zum Buch: ÂŦVorwÃĪrts rÞckwÃĪrts lÃĪdt zu einer kurzweiligen Geschichtsfahrt auf zwei RÃĪdern ein, auf der wir nach jedem Eck ÂŦGenau!Âŧ sagen. Oder aber: ÂŦWusste ich gar nichtÂŧ.
Hauptbildnachweis: Benedikt Meyer chic mit dem Fahrrad unterwegs. PortrÃĪtbild: Benedikt Meyer auf Fahrradtour in der Schweiz.








Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.