Von Raymond Barre, Premierminister unter Frankreichs Präsident Valéry Giscard d’Estaing, stammt das Bonmot: La Suisse est le miroir de nos erreurs.
Inzwischen ist die Schweiz selbst zum Spiegel ihrer Irrtümer geworden: überbevölkert, verstopft, fremdbestimmt, mit erodierender Wohlfahrt der Normalbevölkerung, aus dem Ausland erpresst.
Seit Jahrzehnten durch Asylmissbrauch und Masseneinwanderung geschädigt, ebenso durch erstickende Überbürokratisierung, dysfunktionale Energiewende, schlechte Schulreformen, staatlich verordnete Sprachverschandelung.
Wann hat die Schweiz den Königsweg verlassen?
Ein Blick zurück könnte erhellen, wann und warum der von Premierminister Barre bewunderte Königsweg verlassen wurde.
Er könnte etwa so beschrieben werden: schlanker Staat, wenig Bürokratie und universaler Freihandel, aber keine internationale Einbindung mit Satellisierungsverträgen.
Fokussierung auf eigene Interessen, Freiheiten und Rechte, darunter internationale Kontakt-, Handels-, Gewerbe- und Reisefreiheit.
Friedliche Beziehungen zu allen, aber keine Einmischung in ihre Händel, auch keine geschwätzige Staatskommunikation dazu, also strikte Neutralität. Verbunden mit humanitärer Hilfe und guten Diensten zur Friedensförderung im Interesse aller Völker.
Dieser konservative Königsweg war aussenwirtschaftspolitisch durch das Freihandelsabkommen von 1972 mit der EG (heute EU) sowie mit Teilnahme am globalen Freihandel nach GATT-Regeln gekrönt und laufend weiterentwickelt worden.
Architekt unseres Freihandels war der spätere Bundesrat Hans Schaffner, damals noch Chef des Bundesamtes für Aussenwirtschaft; übrigens der einzige Fall, wo ein Bundesbeamter Bundesrat wurde.
Höchste Verdienste für das Land hatte der brillante Schaffner bereits als Direktor der Zentrale für Kriegswirtschaft, wo es ihm gelang, in Zusammenarbeit mit General Guisan mit einem Mix aus Abschreckung, Kooperationsbereitschaft, guten Diensten und Glück durch Vertragsverhältnisse zu beiden verfeindeten Blöcken die Schweiz aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten.
Smarte 68er: Erst durch die Institutionen marschieren, dann diese beherrschen
Politische Voraussetzung für die Beendigung dieses konservativen, äusserst erfolgreichen Königswegs war der erfolgreiche Marsch der 68er mit ihrem kulturmarxistischen und internationalsozialistischen Programm in unsere Institutionen, die sie inzwischen beherrschen.
Sie sind die neue Macht, das neue tonangebende Establishment, vor dem die meisten kuschen.
Im Verlauf einer revisionistischen Geschichtsschreibung wurde die konservative Schweiz als rückständig, eigenbrötlerisch, unsolidarisch, reformunfähig und aus der Zeit gefallen diffamiert. Dabei haben unsere internen Kritiker und Nestbeschmutzer alle Narrative ausländischer Schweiz-Kritiker nachgeleiert.
Hinterlassen die 1968er eine mottende Staatskrise und ein gespaltenes Land?
Die nun angesagte Integration und internationale Einbindung hatte eine europäische und eine internationale Stossrichtung.
Europapolitisch erfolgte ein Beitritt zum Europarat mit Übernahme der Europäischen Menschenrechtskonvention und Unterstellung unter den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, was uns das skurrile Klimaseniorinnenurteil eingebrockt hat.
Parallel dazu erfolgte eine Annäherung an die EU mit der Perspektive eines Beitritts.
Global war die UNO im Visier unserer Internationalisten. Nachdem ein UNO-Beitritt in zwei Volksabstimmungen abgelehnt worden war, wurde er von Bundesrat Joseph Deiss in einer dritten Abstimmung mit massiver Staatspropaganda aus Steuergeldern durchgedrückt.
Interessant die Begründung: Wir (die Schweiz) würden inzwischen als Nichtmitglied so viel zahlen wie vergleichbare Vollmitglieder, hätten aber nichts zu sagen. Also könnten wir gerade so gut beitreten.
Ähnliches ist zu erwarten, falls das ausgehandelte Rahmenabkommen, ein Satellisierungsvertrag, in einer Volksabstimmung gutgeheissen und ratifiziert würde: Nun haben wir etwa 80% der Nachteile eines EU-Vollbeitritts, aber als quasi Passivmitglied keine Mitbestimmung.
Also können und müssen wir beitreten.
Der EU-Beitrittskurs ist durch das EWR-Nein vom 6.12.1992 jäh gestoppt, aber von der Classe politique nie akzeptiert worden. Das Nein von Volk und Ständen sei ein durch reaktionäre Populisten herbeigeführtes Zufallsergebnis und müsse bei nächster Gelegenheit korrigiert werden.
Seither haben wir eine mottende Staatskrise und sind ein gespaltenes Land.
Das Volk ist der Chef, die Regierung ist die Opposition
Chaotisch, unehrlich und unprofessionell wurde darauf die Europapolitik. Nicht umsonst bemerkte damals der britische Botschafter süffisant, die Schweiz sei das einzige ihm bekannte Land, in dem die Regierung in der Opposition sei.
Anstatt der EU-Kommission höflich mitzuteilen, das Schweizer Volk als oberster Souverän habe eine Teilnahme der Schweiz am EWR entgegen der Empfehlung des Bundesrates abgelehnt, sind Teile der Regierung auf Brustwarzen nach Brüssel gekrochen, um sich für das dumme Volk zu entschuldigen.
Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz beschimpfte die Abstimmungssieger als Neandertaler und bezeichnete den Abstimmungstag als Dimanche noir.
Dabei hätte es Alternativen gegeben: Der höflichen Mitteilung des Abstimmungsergebnisses hätte hinzugefügt werden können, dass die Schweiz ein befreundetes Land bleibe und eine Weiterentwicklung des bilateralen Verhältnisses im beidseitigen Interesse selbstverständlich jederzeit möglich sei – einfach nicht im Rahmen des EWR.
Parallel dazu hätte man bei Konkurrenten der europäischen Autoindustrie ein Erstregistrierungsabkommen sondieren können. Mit der Absicht, dass man Hondas, Hyundais oder Chevrolets ohne weitere Typenprüfung in der Schweiz hätte immatrikulieren können, nicht aber VWs, Peugeots oder Mercedes-Benze. Niemand weiss, ob solches gelungen wäre.
Im Erfolgsfall wäre ein europäischer Aufschrei ertönt: Diskriminierung! Dem hätte entgegnet werden können: Ja, Diskriminierung, aber legale. Warum? Wollt ihr verhandeln?
Vielleicht wäre es gelungen, am nicht zustande gekommenen EWR vorbei auch in unserem Interesse ein gegenseitiges Normenanerkennungs-Abkommen auszuhandeln. Wir wissen es nicht. Es wurde nicht versucht.
Europapolitik: Idealisten alternativlos, Kritiker politisch inkorrekt
Die folgende Europapolitik war geprägt durch Annäherung aus bittstellerischer Nestbeschmutzerpose, nicht honorierten Vorleistungen und masochistischen Entschuldigungsritualen, erklärbar mit der Vorgeschichte.
Auch für unsere schwärmerisch-idealistischen Kulturmarxisten, Internationalsozialisten und Weltverbesserer war das europäische Einigungs- und Integrationsprojekt so alternativlos wie ihre Flüchtlingspolitik und Energiewende für Bundeskanzlerin Merkel.
Eine Kritik daran galt als politisch inkorrekt und stand auf gleicher Stufe wie eine Solidarisierung mit Kinderschändern.
Vielleicht bringt eine nüchterne Betrachtung Klärung. Sie sollte bei den tatsächlichen Agenden der massgeblichen Akteure Frankreich und Deutschland ansetzen und auf schwärmerischen, paneuropäischen Solidaritätsschmus verzichten.
Frankreich galt zwar als Sieger des Zweiten Weltkrieges, stand aber wie Grossbritannien vor dem Verlust seiner Kolonien. Anders als Grossbritannien hielt es sich immer noch für eine Weltmacht. Das europäische Projekt eröffnete ihm dazu eine neue Perspektive: alte Grandeur mit deutschem Geld.
Für die Bundesrepublik waren Westbindung und europäische Integration mit Einwilligung in einen Nettozahlerstatus eine realistische Option, um nach der Katastrophe und den Verbrechen der Hitlerei in den Kreis zivilisierter Mächte zurückzukehren.
Eine erfolgreiche Währungsreform sowie ein von den Westalliierten aufgezwungenes, aber gutes und wettbewerbsfreundliches Grundgesetz hatten zu einem Wirtschaftswunder geführt.
Bereits 1955, also nur zehn Jahre nach der totalen Niederlage und bedingungslosen Kapitulation, verfügte die Bundesbank bereits wieder über 15 Milliarden Dollars an Devisenreserven.
Im kriegszerstörten Deutschland hatte der industrielle Kapitalstock neu aufgebaut werden müssen, was in Kombination mit der hohen Arbeitsmoral dazu geführt hatte, dass die Bundesrepublik nicht nur ein Wirtschaftswunderland, sondern auch Produktivitätsweltmeister wurde.
Mit der Folge, dass seine Exportwirtschaft in der Zollunion der EWG und später im Gemeinsamen Markt die höchsten Exportüberschüsse einfuhr, womit der Nettozahlerstatus versüsst wurde.
Ein wichtiges Ziel der europäischen Einigung bestand nicht nur darin, den allgemeinen Wohlstand durch freie Wettbewerbswirtschaft zu heben, sondern ihn durch freien Personenverkehr und mit den Mitteln von Strukturpolitik und Kohäsionszahlungen anzugleichen. Alles finanziert von den reicheren EU-Ländern.
Reichere, weil produktivere, EU-Länder wurden nicht nur mit Transferzahlungen an die ärmeren belastet. Infolge höherer Einkommen sowie attraktiverer Renten- und Sozialsysteme wurden auch sie (wie die Schweiz) zu Magneten der Masseneinwanderung.
Schielen auf die Schweiz
Deutschland hat inzwischen durch Misswirtschaft, Überbürokratisierung und die grüne Energiewende der Ampel jenen Wirtschaftswunderstatus eingebüsst, den es noch in den ersten Merkel-Jahren dank der Arbeitsmarktreformen von Vorgänger-Kanzler Schröder besessen hatte.
Europäische Drittstaaten wie Norwegen, Island, Liechtenstein oder die Schweiz strebten mit der EU ohne formale Mitgliedschaft eine privilegierte Zusammenarbeit an, sei es im EWR, mit «bilateralen Abkommen» (ein terminologisches Unding, weil alle bisherigen Abkommen ja auch bilateral waren) oder im jetzt ausgehandelten Rahmenabkommen.
In reicheren Mitgliedstaaten sind sowohl der Nettozahlerstatus wie die Masseneinwanderung seit Jahrzehnten im kritischen Fokus von Nationalkonservativen und Souveränisten. Dabei schielen sie neidisch auf die reiche Schweiz, der es ausserhalb der EU so unübersehbar besser geht.
Um Absetzbewegungen zu schwächen und weiteren Austritten wie dem Brexit vorzubeugen, gab es nun eiserne Restriktionen bei Verhandlungen mit Drittstaaten wie der Schweiz. Sie sollten nicht besser behandelt werden dürfen als eigene Nettozahler mit Masseneinwanderung.
Das hätte der Schweiz eine Warnung sein müssen: Die EU würde auf Personenfreizügigkeit und Tributzahlungen für den Zutritt zum Binnenmarkt beharren. Und das bei einem jährlichen Importüberschuss der Schweiz von rund 20 Milliarden Franken.
Zur Erinnerung: Noch Staatssekretär Franz Blankart hatte bei den EWR-Verhandlungen erfolglos versucht, Personenfreizügigkeit zu verhindern. Was damals als Nachteil für die Schweiz beurteilt wurde, soll nun plötzlich ein Vorteil sein?
Sein Konkurrent und Nachfolger als Verhandlungsführer, Staatssekretär Jakob Kellenberger, ist dann bei den Verhandlungen zum ersten Paket der «bilateralen Abkommen» bei der Personenfreizügigkeit eingeknickt.
Was bewirkt eine schrankenlose Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts?
In einer ausführlichen Economiesuisse-Studie vom Oktober 2024 wird trotz nicht verschwiegener Gegenargumente, aber im Widerspruch zu diesen, behauptet, die schrankenlose Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts für die EU habe im Vergleich zum regulierten Zustand vor 2002 bei uns zu mehr Wohlstand und Wohlfahrt geführt.
In der Studie werden anerkennenswerterweise weder Regulierungskosten, Übernutzung der Infrastruktur, Kosten flankierender Massnahmen noch steigende Immobilienpreise und Mieten in den Ballungszentren verschwiegen.
Auch wird das in den letzten Jahren abgeflachte BIP pro Kopf zu Recht mit der eingebrochenen Konjunktur in der EU erklärt. Ebenfalls ist korrekt, dass Arbeitszeit-Verkürzungen der letzten Jahre als reales Wohlstandswachstum interpretiert werden dürfen.
Dennoch ähneln die Studienverfasser Automechanikern, die einen stotternden Verbrennungsmotor an ein teures Diagnosegerät angeschlossen haben, ohne zuerst Motorenöl und Kühlmittel zu kontrollieren.
Dabei würden längst etablierte und in der Praxis verifizierte Theorien der Volkswirtschaftslehre ausreichen: Theorie der komparativen Kosten, Theorie der relativen Preise und des Produktionsoptimums sowie der Wanderungsökonomie.
Masseneinwanderung schädigt Volkswirtschaft der Schweiz
Eine Überprüfung der unregulierten Personenfreizügigkeit auf eine Vereinbarkeit mit diesem etablierten, volkswirtschaftlichen Wissen wäre ohne ausufernde Studie zum gegenteiligen Ergebnis gekommen.
Unregulierte Personenfreizügigkeit mit der EU führt angesichts massiv höherer Einkommen und Sozialleistungen sowie besserer Konjunktur in der Schweiz theoretisch so lange zu Masseneinwanderung, bis ein potentieller Einwanderer keinen Wanderungsgewinn mehr erzielt. Das wäre dann der Fall, wenn die Schweiz bei der Nettowohlfahrt auf EU-Niveau heruntergewirtschaftet sein würde.
Bei regulierter Einwanderung nach Massgabe eigener Interessen sowie guter Konjunktur führt ein ausgetrockneter Arbeitsmarkt zu Lohnsteigerungen. Um die Beschäftigung nicht zu verlieren, müsste die Arbeitsproduktivität durch Rationalisierung und mehr Kapitaleinsatz mindestens gleich stark steigen wie der Lohnsatz.
Ist das nicht möglich oder nicht gewollt, wird die Produktion in lohngünstigere Länder ausgelagert. Der Gewinn käme dann als Kapitaleinkommen zurück in die Schweiz.
«Das war einmal unser Königsweg.»
Markus Eckstein
Das BIP pro Kopf, also das verteilbare Kuchenstück pro Kopf, stiege zweifach: durch höhere Reallöhne und Kapitaleinkommen aus dem Ausland. Und das, ohne dass diese Realeinkommens-Steigerungen durch Verstopfungseffekte, höhere Wohnkosten und zusätzliche Regulierungskosten zunichte gemacht werden.
Das war einmal unser Königsweg.
Das Fazit ist eindeutig: Unregulierte Masseneinwanderung schädigt eine kleine, reiche und bereits überbevölkerte Volkswirtschaft massiv.
Stark verhandeln: Kann das die offizielle Schweiz?
Seit dem vom Establishment nie akzeptierten Volks-Nein zum EWR hat sich die Kadenz schlechter Verhandlungen erhöht.
Es begann bereits vor der EWR-Abstimmung. Ohne den Chefunterhändler Blankart zu konsultieren, reichte der Bundesrat dank Stichentscheid von Adolf Ogi ein Beitrittsgesuch ein.
So unterlief er die eigene Argumentation, der EWR sei eine stabile, eigenständige Lösung ohne Folgezwang zu einem Vollbeitritt. Damit kumulierten sich in der Abstimmung EWR-Gegner mit Beitrittsgegnern.
Zudem sickerte durch, dass Bundesrat Delamuraz vor der Abstimmung herumprahlte, er werde dann EU-Kommissar, was nur nach einem Schweizer EU-Beitritt möglich gewesen wäre.
In der Folge häuften sich Unehrlichkeiten und eitelkeitsgetriebene Dummheiten: So hat Bundesrat Moritz Leuenberger Verkehrsverhandlungen mit der EU persönlich geführt und Verhandlungsziele am Fernsehen hinausposaunt.
Das war zweifach unprofessionell: Wer öffentlich Verhandlungsziele kommuniziert, verliert an Flexibilität für Kompromisse. Ein Minister sollte niemals selbst verhandeln, sondern das bevollmächtigten Beamten überlassen, die er bei schlechtem Ergebnis im Regen stehen lassen kann, ohne selbst das Gesicht zu verlieren.
Unehrliche Doppelzüngigkeit belastete auch die «bilateralen Verhandlungen». Der EU wurde signalisiert, sie seien eine Vorstufe zu einem Vollbeitritt. Die Schweizer seien eben etwas langsam und brauchten mehr Zeit.
Nach innen wurden die «Bilateralen» als eigenständiger und vollwertiger Ersatz für den abgelehnten EWR verkauft, ohne Verpflichtungen zur automatischen Übernahme von weiteren EU-Regulierungen.
Mit zunehmend erkennbarer Misswirtschaft in der EU hat sich der Bundesrat vom zuvor erklärten Beitrittsziel distanziert. Verständlich, dass sich die EU getäuscht und hinters Licht geführt vorkam. Um weiterer «Rosinenpickerei» vorzubeugen, verlangte sie nun ein Rahmenabkommen.
Scheinerfolge als «Durchbruch» verschleiern
Die angeblichen Durchbrüche beim Rahmenabkommen sind Scheinerfolge. Im Kern geht es um eine Anbindung an einen heruntergewirtschafteten, überschuldeten Staatenbund, dessen dysfunktionales, französisches Bürokratiemodell inzwischen nicht nur Frankreich, sondern die ganze EU massiv geschädigt hat.
Die Scheinerfolge beim «Durchbruch» verschleiern, dass das Rahmenabkommen eigentlich eine Art EWR light ist, mit Verpflichtung zur Übernahme der ganzen, binnenmarktrelevanten Überbürokratisierung à la française, was ja Hauptgrund für den wirtschaftlichen Niedergang der EU ist.
Befürworter entgegnen, die Schweiz würde im autonomen Nachvollzug bereits viele EU-Regelungen übernehmen. Das trifft zu. Diese Übernahmen erfolgen aber im eigenen Interesse und sind nicht Ausfluss einer staatsvertraglichen Pflicht gegen eigene Interessen.
Bei den Kohäsionszahlungen wird erwähnt, dass EWR-Mitglieder wie Norwegen noch mehr zahlen. Auch das stimmt. Sie tun es aus der Logik der Vollmitglieder mit Nettozahlerstatus.
In keinem Freihandelsabkommen werden Marktzutrittsgebühren verlangt, auch nicht im Freihandelsabkommen der Schweiz mit der damaligen EG von 1972. Freihandel ist ein wohlstandssteigerndes Prinzip für alle Teilnehmer.
Tributzahlungen dafür sind systemwidrig und können nur mit der Vorgeschichte erklärt werden, als sowohl Norwegen wie die Schweiz noch in die EU wollten, wo ihnen ohnehin ein Nettozahlerstatus geblüht hätte.
«Halbdirekte Demokratie, Neutralität und Föderalismus sind die Essenz, Demokratie von unten und Selbstbestimmung das Konstruktionsprinzip einer freien Schweiz.»
Markus Eckstein
Die Schweiz ist, solange sie anders ist
Wie schrieb der pensionierte Diplomat und Historiker Paul Widmer: „«Die Schweiz ist anders. Sonst ist sie nicht mehr die Schweiz.»
Halbdirekte Demokratie, Neutralität und Föderalismus sind die Essenz, Demokratie von unten und Selbstbestimmung das Konstruktionsprinzip einer freien Schweiz. Deshalb ist dieses Rahmenabkommen als Kolonialvertrag abzulehnen.
Es würde unsere wertvollsten politischen Freiheiten, Rechte und Grundsätze beseitigen und uns zu einer Micky Maus-Demokratie machen. Die Schweiz wäre wirklich nicht mehr die Schweiz.
Vorbildliche Regierung?
Es ist zu erwarten, dass das Rahmenabkommen vom Parlament durchgewinkt und der Entscheid dem Volk zugeschoben wird. Nicht ungeschickt, denn so kann die Classe politique im Fall einer Ablehnung durch das Volk vor der EU das Gesicht wahren, über das störrische Volk klagen und sich heimlich darüber freuen.
Die EU wird verärgert sein, eine Zeit lang schmollen und sich eventuell zu Bestrafungen hinreissen lassen. Auch ausserhalb Europas wird angesichts einer globalisierten Welt der Dauerdruck auf die Schweiz zunehmen.
Daraus den Schluss zu ziehen, wir müssten uns halt unterwerfen, wäre fatal.
Erpressungen und Übergriffe der Grossmächte während beider Weltkriege waren stärker als der gegenwärtige internationale Druck. Standhaftigkeit und Schlauheit unserer damaligen Regierungen sollten uns Vorbild sein.
Wir müssen auch heute standhaft bleiben, uns schlau machen, hie und da um den Brei herumreden und nötigenfalls die Hosen halb herunterlassen, um schmerzhaftere Konzessionen zu vermeiden.
Alternativen zur Unterwerfung
Es gibt Alternativen zur Unterwerfung.
Im Fall von Diskriminierung und schlechter Behandlung sollten alle legalen Retorsionsmöglichkeiten ausgelotet und gute Beziehungen zu den Feinden und Rivalen unserer Erpresser aufgebaut werden.
Weitere Freihandelsabkommen in Kombination mit Friedensdiensten würden uns wirtschaftlich breiter aufstellen sowie unseren Ruf als friedliches, gut wirtschaftendes Land festigen.
In einem wichtigen Bereich der Lösung wären wir völlig autonom: bei der Beseitigung unserer selbstverschuldeten Überbürokratisierung.
Zur Entbürokratisierung ist ein argentinisches Programm unter Präsident Javier Milei im Gang. Wir sollten das Experiment sorgfältig studieren und erfolgreiche Teile übernehmen.
Um das umzusetzen, müssen wir frei und handlungsfähig bleiben und dürfen kein Vasallenstaat eines überbürokratisierten Monsters werden.
Der Artikel erschien zuerst auf Inside Paradeplatz.
Kurzporträt Markus Eckstein

Markus Eckstein liebt den freigeistigen Alleingang. Er selbst ist der 68er-Bewegung entsprungen und zu ihr in Opposition gegangen. Seine Weltanschauung fusst auf der Erkenntnis: Zu viel Macht tut dem Menschen nicht gut.
Er engagiert sich als Schriftsteller, Kabarettist und verfasste mehrere Bücher. Mehr zu Markus Eckstein.
Hauptbildnachweis: Stux auf Pixabay. Porträtbild: St. Galler Tagblatt.





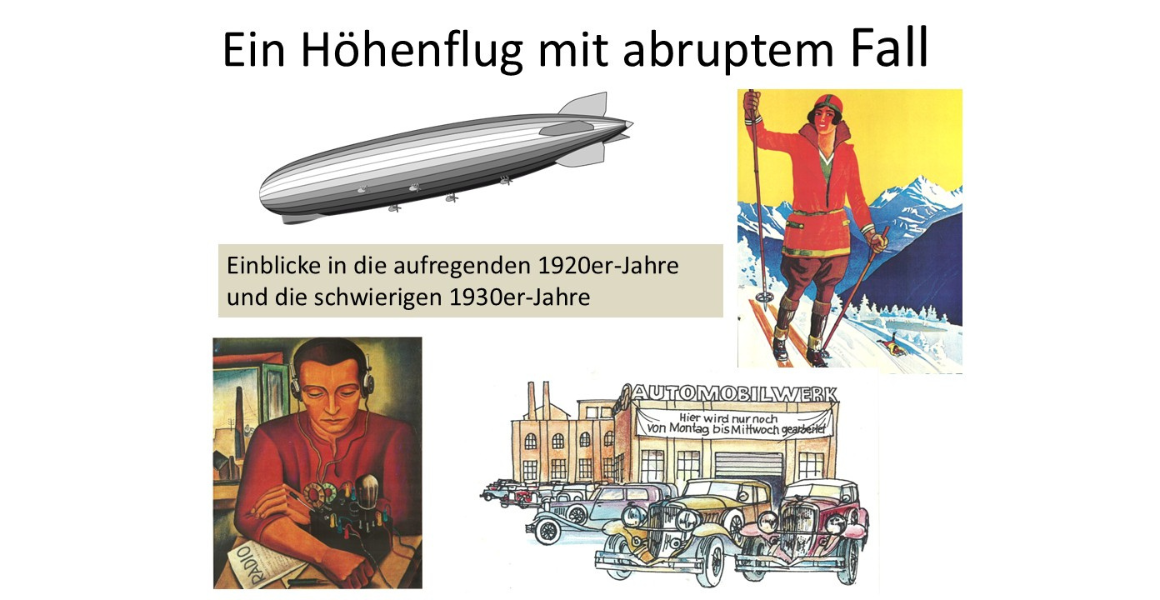


Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.