Heute nehme ich die Schweiz als Land der verkannten Stärken wahr. Als ein Land, dessen Qualitäten, Werte und Eigenheiten zunehmend im Schatten der globalen Einheitskultur stehen, und das Gefahr läuft, zwischen falscher Bescheidenheit und innerer Selbstzerfleischung seine eigene Grösse und globale Bedeutung zu unterschätzen.
Nährboden für substanzielle Ideen und Visionäre
Natürlich fällt es schwer, die Schweiz als Protagonistin der Globalisierung zu verstehen, und sicher sind wir auch nicht gemeinhin die Heimat der disruptiven Visionäre. Und doch: Die Schweiz bietet traditionell den Nährboden, auf dem Ideen gediehen, welche die Menschheit prägten und nachhaltig beeinflussten.
Denken wir an den Schweizer Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, der mit seinen Schriften die amerikanische Verfassung beeinflusste und als Urvater der ökologischen Bewegung gilt, an Paracelsus, der das Tor zur modernen Medizin öffnete, an Johann Heinrich Pestalozzi, an Henry Dunant, an den Reformatoren Zwingli oder etwa an Calvin, ohne dessen Denken es die kapitalistische Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen, nicht gäbe.
Und auch im Umfeld von Bauen und Architektur, mit dem ich mich beruflich befasse, finden sich zahlreiche Schweizer Ausnahmeerscheinungen mit weltweiter Ausstrahlung. Ich erinnere an Domenico Fontane, Erbauer des Petersdoms, an Francesco Borromini, den Architekten der Renaissance-Päpste, an den Visionär Le Corbusier und natürlich an unsere Zeitgenossen Botta, Zumthor oder Herzog & de Meuron.
Erfolg durch «rede mitenand!»
Die Schweiz ist zweifellos eines der erfolgreichsten Länder der Welt. Und auf diesen Erfolg dürfen wir stolz sein. Toleranz, Offenheit, Rechtschaffenheit, eine spezifische, schweizerische Dialogkultur sowie ökonomische Stabilität sind jene Basis, welche geistigen Freiraum schafft, um Grosses entstehen zu lassen. Ein Eckpfeiler der Schweizer Erfolgsgeschichte ist der Dialog an der Basis. Diesen Bottom-up-Dialog sehe ich als verkannte Schweizer Kernkompetenz, die im Zuge der Globalisierung an Relevanz zu verlieren droht.
«Ein Eckpfeiler der Schweizer Erfolgsgeschichte ist der Dialog an der Basis. Diesen Bottom-up-Dialog sehe ich als verkannte Schweizer Kernkompetenz, die im Zuge der Globalisierung an Relevanz zu verlieren droht.»
Werner Schaeppi
Dabei wäre gerade dieser demokratische Dialog eine Antwort auf viele aktuelle Herausforderungen unserer Zeit. Bottom-up-Dialog heisst, alle Beteiligten in den Kommunikationsprozess einzubeziehen oder, wie unsere Vorfahren noch zu sagen pflegten, «Du chasch vom tümmschte Siëch no öppis lehre!» Den Wert der Schweizer Dialogkultur an der Basis sehe ich nicht im nivellierenden Kompromiss, bei dem grosse Ideen bisweilen zum langweiligen pragmatischen Abklatsch verkommen. Nein: das Wesen und die Essenz des Schweizer Dialogs ist, dass er durch Respekt und Wertschätzung Sichtbarkeit erzeugt.
Die Schweizer Kommunikationstugend basiert auf dem Fakt, dass sie jedermann eine Stimme gibt. Jeder hat das Recht und darf im Gefühl leben, dass seine Meinung es wert ist, gehört zu werden. Dieses Empfinden ist die Basis unseres Selbstverständnisses, unserer kollektiven und individuellen Identität.
Fehlende Sichtbarkeit oder Nicht-Beachtung scheint im Grossen ein Treiber für die Globalisierungsängste breiter Massen und im Kleinen die Quelle für den verbreiteten negativen Trend zum Nein-Sagen, Verweigern, Verzögern. Er ist im Alltag Auslöser für den Wunsch nach Abschottung, Missgunst, Sturheit und Nörglertum. Gerade im Kontext städtebaulicher und baulicher Entwicklung beobachte ich eine neue, negative Qualität, Veränderungen als Bedrohungen statt als Chance zu verstehen. Die Folge dieser Haltung sind Verzögerungen und Verhinderungen durch Einsprachen, Prozesse, Prinzipienreiterei und letztlich das Gefühl, wonach jeder seine persönlichen Partikularinteressen durchsetzen wolle.
Diesen Trend als Ausdruck von kleingeistiger, schweizerischer Biederkeit abzutun, wäre zu kurz gegriffen. Der Verweigerungsvirus hat auch an sich weltoffene, gebildete Kreise erreicht. Aufgrund der grassierenden Selbstzentriertheit und der Wertvorstellung, dass Durchsetzungsfähigkeit mit Stärke und Erfolg korreliert, sinkt die Bereitschaft, neue Ansätze, Visionen und Projekte offen und konziliant zu bewerten. So kommt es, dass das Bild vom halbleeren Glas zunehmend die Sicht auf die Zukunft prägt.

Schweizerische Dialog-Kultur
Die Schweizer Kultur des Bottom-up-Dialoges bietet sich hier als erfolgsversprechender Ansatz an. Der Dialog erzeugt nicht nur Sichtbarkeit, sondern öffnet auch den Blick auf das Ganze. Alleine diese Erweiterung des Horizontes führt dazu, dass der Blick auf die Chancen einer Veränderung gerichtet wird und sich die Sicht vom sturen Eigeninteresse auf das gemeinsame Interesse verlagert. Natürlich: Der Dialog mit den Stakeholdern eines Projektes ist aufwändig, bisweilen hart und nervenaufreibend, mit Kosten verbunden und nicht immer erfolgreich. Einsprachen, Rechtsstreitigkeiten und Bauverzögerungen sind aber in der Regel um vieles teurer und destruktiver. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Kommunikation rund um bauliche und städtebauliche Veränderungen zeigt, dass oft allein schon die frühzeitige, transparente und gesprächsoffene Diskussion eines Anliegens genügt, um verhärtete Fronten zu besänftigen. Die Wahrnehmung des Problems wird manchmal zur Lösung, womit ich wieder beim Begriff der Sichtbarkeit angekommen bin. Sichtbarkeit oder Beachtung gibt dem Menschen jene Würde, die es ihm erlaubt, tolerant und offen zu sein.
«Sichtbarkeit oder Beachtung gibt dem Menschen jene Würde,
Werner Schaeppi
die es ihm erlaubt, tolerant und offen zu sein.»
Zu den eigenen Stärken stehen
Ich wünsche mir eine konstruktivere, fröhlichere und selbstsicherere Schweiz. Eine tolerante, visionäre, integrierende Schweiz, die ihre Stärken pflegt und bewahrt. Unser Land darf für mich gegenüber Europa und der Welt lautstark und mit Stolz sein basisdemokratisches Bottom-up-Modell als Gegenpol zum dominierenden Top-down-Modell vertreten.
Ich wünsche mir Schweizer und Schweizerinnen, welche sich nicht durch die vermeintliche Effizienz autoritärer Haltung beirren lassen, wie sie derzeit selbstinszenierte Alleinherrscher, streng hierarchisch geführte Nationen und selbst globale Konzerne zelebrieren. Um Zwingli zu zitieren: «Die grosse Zahl macht nicht die Wahrheit».
Gerade in einer Zeit, in der langjährige Freundschaften und Bündnisse, gemeinsame Werte und Ideale zu zerbrechen drohen, müssen wir uns, als kleines Land inmitten eines verunsicherten Europas, auf unsere ideellen Stärken besinnen. Was wir zur Lösung von Konflikten beitragen können, ist nicht unser ökonomisches Gewicht und schon gar nicht militärische Stärke, sondern Erfahrung und Wissen im Umgang mit unterschiedlichen Standpunkten und Interessen.
Als Willensnation ist der Dialog zwischen den Landesteilen, in den Kantonen, in den Gemeinden, aber auch der Dialog zwischen den Sozialpartnern sowie unter den verschiedenen Gesellschaftsschichten Teil unserer DNA und unseres Wohlstandes. Erklären wir dies unseren Partnern in Europa und in der Welt. Erklären wir dies unseren ausländischen Arbeitskollegen, unseren Expats und ausländischen Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung. Legen wir unsere schweizerische Bescheidenheit ab: Ich wünsche mir eine Schweiz, die ihre Ideen mit der Vehemenz und Überzeugung unserer grossen Vorfahren vertritt.
Kurzporträt Dr. Werner Schaeppi
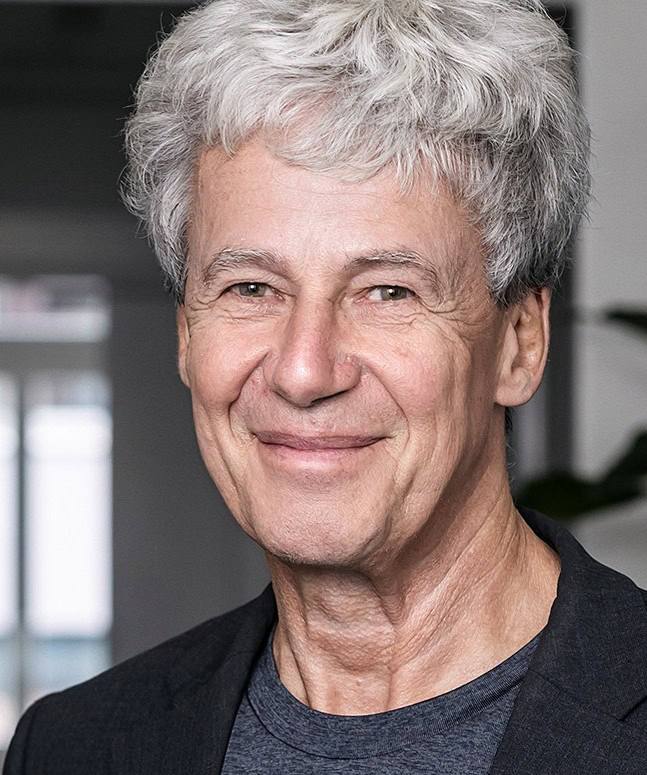
Der fĂĽr SICHTWEISENSCHWEIZ.CH aktualisierte Beitrag erschien zuerst in Pro Schweiz im Verlag der Schweizerischen Vereinigung Pro Libertate.
Bildnachweis: Dialog ist im baulichen und politischen Umfeld fundamental: Am 9. Februar 2025 stimmten die Zuger Stimmberechtigten mit 71% Ja-Stimmen dem Bebauungsplan GIBZ mit Wohnhochhaus Pi deutlich zu. © Visualisierung: Filippo Bolognese; Architektur: Duplex Architekten.
Mehr auf SICHTWEISENSCHWEIZ.CH zur Dialogkultur in der Schweiz: «Heute Abstimmung! Das mächtige Schweizer Volk kann alles, tut aber nicht alles»








Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.