In der Schweiz grĂ¼nden jährlich Ă¼ber 40’000 Macherinnen und Macher ein Unternehmen. 83 Prozent von ihnen sind Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Die wenigsten von ihnen zählen zu den FirmengrĂ¼ndern von sogenannten «Start-ups», die in wachstumsträchtigen Wirtschaftsbereichen mit Millionenbeträgen von Investoren gefördert werden und dadurch medial am meisten Aufmerksamkeit erhalten.
Die meisten FirmengrĂ¼nder suchen eine sinnvollere Berufstätigkeit, wollen ihre Ideen verwirklichen, freier und flexibler arbeiten – und dabei erkannte Marktchancen nutzen. Sie gehen dafĂ¼r hohe Risiken des Scheiterns ein, denn in der Schweiz sind 50 von 100 neu gegrĂ¼ndeten Start-ups nach fĂ¼nf Jahren vom Markt wieder verschwunden.
Norbert Winistörfer ist diplomierter Betriebsökonom und Journalist, seit 25 Jahren arbeitet er als Professor fĂ¼r Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz – und er ist Autor des Schweizer Standardwerks fĂ¼r UnternehmensgrĂ¼ndungen, das im Spätsommer 2025 bereits in 18. Auflage (!) erscheint.
Welche Sichtweisen hat Norbert Winistörfer, der Autor des Schweizer Standardwerks «Ich mache mich selbständig», zum Start-up-Land Schweiz?
Welche GrĂ¼nde haben in der Vergangenheit zum Erfolg des Start-up-Lands Schweiz gefĂ¼hrt?
Norbert Winistörfer: «Zur Beantwortung der Frage ist zuerst der Begriff «Start-up» zu definieren. Denn dieser ist mit einer besonderen Aura umgebenen und wird ganz unterschiedlich verwendet.
FĂ¼r Risikokapitalgeber sind Start-ups neu gegrĂ¼ndete Unternehmen mit einem Kapitalbedarf in ein- oder zweistelliger Millionenhöhe. Die meist forschungsgetriebenen Jungfirmen werden dabei dank ihrer innovativen Geschäftsideen in zukunftsträchtigen, wachstumsstarken Branchen wie der Tech-Industrie als reine Rendite-Objekte betrachtet. Sie sollen den Venture-Kapitalisten – etwas Ă¼berhöht als Business-Angels bezeichnet – möglichst rasch einen hohen Return on Investment generieren. Andere Faktoren, wie die Schaffung von langfristigen Arbeitsplätzen fĂ¼r qualifizierte Fachleute, ethisch und ökologisch vorbildliches Handeln oder Fortschritt durch Technologievorsprung fĂ¼r die Schweiz sind eher Nebensache. Im Idealfall profitieren bei diesem Risikogeschäft alle Beteiligten, im schlechtesten Fall gibt es nur Verlierer.
«Wird dem Begriff «Start-up» der Glamour genommen,
Norbert Winistörfer, Buchautor «Ich mache mich selbständig»
verblasst dieser rasch. Ăœbrig bleibt eine schlichte FirmengrĂ¼ndung».
Zurzeit harzt das Start-up-Business in der Schweiz. In den letzten zwei Jahren gingen die Investitionen in Start-ups gemäss dem Swiss Venture Capital Report um 34,8 und 8,5 Prozent zurĂ¼ck. Erstmals sank auch die Zahl der Finanzierungsrunden um 10 Prozent. Die Start-ups haben zunehmend MĂ¼he, Schweizer Investoren zu finden. Oft ist der hiesige Markt zu klein fĂ¼r die erhofften Gewinne.
Das zwingt Jungunternehmen zur Flucht ins Ausland – oder zur Geschäftsaufgabe.
Wirtschaftsmedien präsentieren Start-up-GrĂ¼ndende gerne als Stars in Helden-Geschichten. Dabei generieren besonders Frauen als Minderheit bei den FirmengrĂ¼ndungen publizistisch mehr Aufmerksamkeit als der dominierende männliche Unternehmer. Das medial glorifizierende Hero-Storytelling fĂ¼hrt leicht zu einem verzerrten Bild der Ă¼berschaubaren schweizerischen Start-up-Szene. Denn sie hat wenig mit dem typischen Schweizer Unternehmertum zu tun, das von rund 620’000 KMU – das sind 99,7 Prozent aller Firmen in der Schweiz – dominiert wird. Vor zehn Jahren waren es erst 584’000 KMU, damals gab es aber auch 375’000 weniger Beschäftigte in der Schweiz.
Wird dem Begriff «Start-up» der Glamour genommen, verblasst dieser rasch. Ăœbrig bleibt eine schlichte «FirmengrĂ¼ndung». Im Idealfall erfolgt eine solche von intrinsisch motivierten Machern und Macherinnen, die sich dank ihrer einzigartigen Geschäftsidee im Markt etablieren und damit ein Einkommen zum Ăœberleben generieren können. Zunehmend ist die FirmengrĂ¼ndung fĂ¼r angestellte Arbeitskräfte aber eine Flucht aus einem sinnentleerten Job in engen hierarchischen Strukturen mit fĂ¼hrungsschwachen Vorgesetzten, die Mitarbeitenden zu wenig Wertschätzung entgegenbringen. Auch fĂ¼r Arbeitslose ohne Wiedereinstiegschancen kann die FirmengrĂ¼ndung eine Option sein, als letzter Weg zurĂ¼ck ins Arbeitsleben. Perspektivlosigkeit ist jedoch keine ideale Triebfeder – meist fehlt dann eine visionäre Geschäftsidee.

Die Schweizer Unternehmer-Szene boomt nicht. In den letzten zehn Jahren wurden gesamtschweizerisch zwar jährlich zwischen 39‘000 bis 47‘000 Unternehmen gegrĂ¼ndet. Davon machen die oben beschriebenen High-Tech-Start-ups nur einen Bruchteil aus. Die meisten neuen Firmen entstehen in etablierten Branchen und herkömmlichen Geschäftsfeldern – und sind sehr klein. 83 Prozent der NeugrĂ¼ndungen beschäftigen lediglich eine Person, 15 Prozent zwischen zwei und vier Personen. Diese sogenannten Mikrounternehmen (Unternehmenskategorie mit bis zu zehn Beschäftigten) machen 90 Prozent aller marktwirtschaftlichen Unternehmen in der Schweiz aus und bilden das Fundament und RĂ¼ckgrat der Schweizer Wirtschaft.
Die Erfolgsbilanz der NeugrĂ¼ndungen in der Schweiz ist relativ ernĂ¼chternd. Nach fĂ¼nf Jahren ist die Hälfte der Firmen wieder verschwunden. Sie wurden aus dem Markt gedrängt, erwirtschafteten zu wenig Gewinn oder Ă¼berforderten die Kräfte der GrĂ¼nderinnen und GrĂ¼nder. Die beschränkte Ăœberlebensfähigkeit zeigt sich auch in den jährlich zunehmenden Firmenkonkursen. Je nach Statistik sind es schweizweit inzwischen Ă¼ber 15’000.»
«Kann man bei diesen Zahlen von einem erfolgreichen Start-up-Land sprechen, wie die gestellte Frage es erwarten lässt? Nein. Umso mehr Respekt verdienen all jene, die mit Blick auf Fakten ein Unternehmen grĂ¼nden.»
Warum ist die Schweiz als Start-up-Land heute erfolgreich?
Norbert Winistörfer: «Wie schon in der Antwort zur ersten Frage ersichtlich, ist die Schweiz kritisch und nĂ¼chtern betrachtet kein Land, in dem das Unternehmertum ein blĂ¼hendes Dasein fristet. Im Gegenteil: In den letzten zwanzig Jahren ist der prozentuale Anteil der Selbständigerwerbenden und der im Unternehmen mitarbeitenden Familienmitglieder in der Erwerbsbevölkerung leicht gesunken. Aktuell weist das Bundesamt fĂ¼r Statistik insgesamt noch 9,3 Prozent Selbständigerwerbende und 1,6 Prozent mitarbeitende Familienmitglieder aus. Der Trend zeigt weiter nach unten.
Auch im internationalen Vergleich weist die Schweiz keine Ă¼berdurchschnittliche Rate an Selb-ständigerwerbenden auf. Wir erreichen nur EU-Durchschnittswerte.
Ganze 10 Prozent der Menschen in der Schweiz haben Lust, in den nächsten drei Jahren ein Unternehmen zu grĂ¼nden.
Gemäss dem neusten Global Entrepreneurship Monitor GEM beabsichtigen dies in den USA rund 14 Prozent, in Frankreich 16 und in Kroatien fast 20 Prozent.
Die GrĂ¼nde fĂ¼r diese verhaltene Bereitschaft zur FirmengrĂ¼ndung sind vielfältig: Den meisten Arbeitnehmenden geht es in der Schweiz wirtschaftlich wohl (noch) zu gut. Sie sind nicht gezwungen, den risikoreichen Schritt in die Selbständigkeit mit höchst unsicherem Ausgang zu wagen. Ein regelmässiges fixes Salär aufs Lohnkonto scheint ihnen attraktiver als die ständige Ungewissheit, ob sich der gewĂ¼nschte Lebensstil mit dem Ertrag aus der eigenen Firma langfristig problemlos finanzieren lässt. Beängstigend ist zudem fĂ¼r viele, dass sie als Selbständigerwerbende bei den Sozialversicherungen bisherige, geschätzte Arbeitnehmervorteile verlieren.
«700’000 geschäftstĂ¼chtige Firmeninhaber und -inhaberinnen bringen der Schweiz insgesamt mehr als ein gehyptes Unicorn.»
Norbert Winistörfer
Seien wir ehrlich: Wer will schon freiwillig als Selbständigerwerbender jährlich die statistisch ausgewiesenen 40 Prozent weniger verdienen als eine angestellte FĂ¼hrungskraft und dafĂ¼r 25 Prozent mehr arbeiten, weniger Ferien beziehen und später in Pension gehen? Wer möchte sich ohne Zwang viele zusätzliche Sorgen im Leben aufbĂ¼rden, an schlaflosen Nächten leiden und ständig an einem Burnout vorbeischrammen? Der Preis fĂ¼r all diese Nachteile als Unternehmer oder Unternehmerin muss sich lohnen, damit sich jemand aus der Komfortzone wagt und sich fĂ¼r diesen Schritt entscheidet.
Belohnt wird der Mut zur beruflichen Selbständigkeit in den meisten Fällen glĂ¼cklicherweise mit wichtigen immateriellen Werten. Unter anderem in Form von gewonnenen Freiräumen, mehr Selbstbestimmung, der Verwirklichung von Lebensträumen. Wenn dazu noch die Aufwand-Ertragsrechnung stimmt, will kaum ein Selbständigerwerbender zurĂ¼ck in den Angestelltenstatus, wie Studien zeigen. Einigen erfolgreichen Unternehmern gelingt es gar, ihre jahrelange Aufbauarbeit oder ihr Lebenswerk zu vergolden, indem sie ihr Start-up oder ihre etablierte Firme einem Investor verkaufen können. Gemäss Umfragen sind aber in der Schweiz gegenwärtig Ă¼ber 100’000 Firmeninhaber vergeblich auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern.
Um ein ausgeprägtes Start-up-Land zu sein, sind wir in der Schweiz mehrheitlich wohl zu wenig risikofreudig beziehungsweise zu sicherheitsorientiert. Was gar nicht schlecht ist, weil längst nicht jede Person eine Unternehmenspersönlichkeit ist.
Seien wir in unserem Microunternehmer-Land also stolz auf die zurzeit Ă¼ber 700’000 geschäftstĂ¼chtigen, hart arbeitenden Firmeninhaber und -inhaberinnen, die in meist umkämpften Märkten bewundernswerte Leistungen erbringen und einen entscheidenden Beitrag zu unserem Wohlstand leisten. Sie verdienen grössere Anerkennung als nur ein Schattendasein neben blendenden Start-ups. Sie bringen der Schweiz insgesamt mehr als ein gehyptes Unicorn (Start-up mit einem Marktwert von mindestens einer Milliarde US-Dollars), das sich möglicherweise nach unerwartet disruptiven Marktentwicklungen als Luftschloss entpuppt.
Was braucht es, was stimmt Sie zuversichtlich, dass die Schweiz auch in Zukunft als Start-up-Land erfolgreich sein wird?
Norbert Winistörfer: «Ein breit abgestĂ¼tztes, an langfristigen Zielen orientiertes, solides und innovatives Unternehmertum ist die Basis einer prosperierenden Volkswirtschaft. Dieser Konsens besteht bei den entscheidenden Akteuren in der Schweizer Politik, Regierung und Verwaltung durchaus. Ihr Handeln entspricht aber oft nur ansatzweise ihren Lippenbekenntnissen. Sie sorgen mit neuen Gesetzen, Verordnungen und Auflagen fĂ¼r Ăœberregulierungen. Und einen Administrationsaufwand, die Unternehmerinnen und Unternehmern verzweifeln lassen. 60 Prozent der KMU empfinden beispielsweise die administrative Belastung im Geschäftsalltag als zu hoch. Das liesse sich mit einem ausgeprägteren wirtschaftsorientierten Denken, noch liberaleren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie digitalisierten Prozessen verbessern.
In einem zu wirtschaftsunfreundlichen Umfeld nĂ¼tzen schliesslich auch die in den letzten Jahren entwickelten Beratungs- und UnterstĂ¼tzungsangebote der öffentlichen Hand und von Nonprofit-Organisationen wenig, um potenzielle FirmengrĂ¼nder fĂ¼r diesen Schritt zu motivieren und sie auf ihrem Weg zu unterstĂ¼tzen. Ebenso verpuffen alle Anstrengungen der universitären Hochschulen und Fachhochschulen, die ihre Studierenden mit speziellen Studiengängen und Programmen, kompetitiven Wettbewerben und prestigeträchtigen Awards fĂ¼r das Unternehmertum zu begeistern versuchen.
«Einen alles umfassenden digitalen One-Stop-Shop fĂ¼r FirmengrĂ¼ndende gibt es leider noch nicht.»
Norbert Winistörfer
Die Motivation zur FirmengrĂ¼ndung wird in der Schweiz schon gedämpft durch den im internationalen Vergleich nach wie vor zu komplexen, langwierigen und kostspieligen GrĂ¼ndungsprozess. Die dafĂ¼r entwickelten Online-Plattformen sind in den letzten Jahren zwar stetig ausgebaut worden. Einen alles umfassenden digitalen One-Stop-Shop fĂ¼r FirmengrĂ¼ndende gibt es leider noch nicht.
Es bräuchte aber noch weitere Anreize fĂ¼r potenzielle FirmengrĂ¼ndende, um das Unternehmertum in der Schweiz zu attraktivieren. WĂ¼nschenswert wäre etwa die schon öfters diskutierte Idee einer speziellen Arbeitslosenversicherung fĂ¼r Selbständigerwerbende – ein Auffangnetz, wie es fĂ¼r Arbeitnehmende gibt. Der kĂ¼rzliche Bericht des Bundesrates auf ein entsprechendes Postulat ist klar ausgefallen: Unternehmer sollen mit ihrer Tätigkeit verbundene Risiken selbst tragen.
Start-up-Förderung, effiziente digitalisierte GrĂ¼ndungsprozesse und verbesserte soziale Absicherung allein lösen aber ein zentrales Problem von klassischen Start-ups noch nicht: erfolgreiche Neuunternehmen langfristig in der Schweiz zu behalten.
Heute werden viele Start-up-Perlen oft schon in frĂ¼hen Entwicklungsstadien von kapitalkräftigen ausländischen Grossfirmen Ă¼bernommen. Mit dem negativen Effekt, dass die Schweiz langfristig zu wenig von ihren Anstrengungen der Start-up-Förderung profitiert, weil das Kapital, neue Technologien, Arbeitsplätze, Steuersubstrat und das Know-how innovativer Fachkräfte ins Ausland abwandern.
Besonders bitter ist das bei Spin-Offs hochqualifizierter Studienabgänger weltweit renommierter Schweizer Elite-Hochschulen; schliesslich haben die Steuerzahlenden in der Schweiz den Unternehmenserfolg mit der Finanzierung der Ausbildungskosten mitermöglicht. Hier wären faire Regeln und Mechanismen notwendig, damit es am Schluss fĂ¼r alle direkt und indirekt Beteiligten zu einer Win-win-Situation kommt.
Um das Unternehmertum in der Schweizer Gesellschaft zu fördern, bräuchte es im Weiteren in verschiedenen Bereichen einen Kulturwandel. So ist es fĂ¼r Start-ups mit reiner Frauen-Power in der männlich dominierten Wirtschaftswelt nach wie vor schwieriger, an Kapital zu kommen, weil die Geschäftspartner offenbar zu wenig an ihre unternehmerischen Fähigkeit glauben. Eine unhaltbare und unwĂ¼rdige Situation im Gender-Zeitalter.
Einen Kulturwandel braucht es in der Schweiz auch bezĂ¼glich des sozialen Status von Unternehmern und Unternehmerinnen. Denn wer in diesem Land mit seinen ambitionierten Geschäftsplänen (selbst wegen nicht beeinflussbaren GrĂ¼nden) scheitert, der erntet vielfach nur Häme.
FĂ¼r geschäftliche Misserfolge gibt es in unserer Gesellschaft keine Anerkennung fĂ¼r den aufgebrachten Mut, kein aufmunterndes Schulterklopfen, kein Wohlwollen und oder UnterstĂ¼tzung fĂ¼r einen Neustart.
Wer scheitert, ist als Versager abgestempelt. Dabei sind FirmengrĂ¼nder und -grĂ¼nderinnen tatsächlich Helden und Heldinnen – nicht nur fĂ¼r auflagenfördernde Erfolgsgeschichten in den Schweizer Wirtschaftsmedien, sondern fĂ¼r unser Land.»
Kurzporträt Norbert Winistörfer

Buchempfehlung
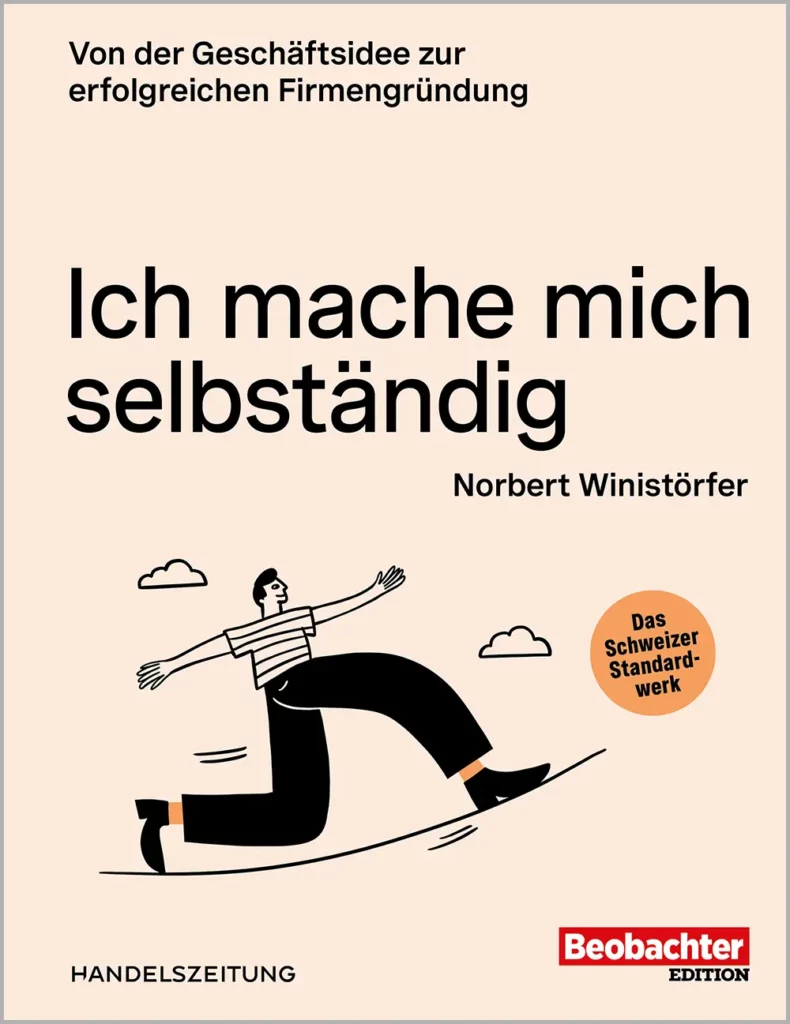
Sie planen ein Start-up und möchten das Buch «Ich mache mich selbständig» von Norbert Winistörfer lesen? Edition Beobachter.

Anne-CĂ©line «Anci» Bordier grĂ¼ndete 2020 die Firma «HĂ„PP(L)IMACHER» (Bildnachweis)

«Nach schwerer Krankheit habe ich mich dazu entschlossen, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und grĂ¼ndete HĂ„PP(L)IMACHER» sagt Anne-CĂ©line, die zuvor vielfältige Erfahrungen sammelte: Erstausbildung zum Koch, Erfahrungen in der Gastronomie, Ausbildung zur Fleischverkäuferin, Chefmetzgerin bei der Migros, Abschluss an einer Handelsschule.

Aktualisiert 14. April 2025
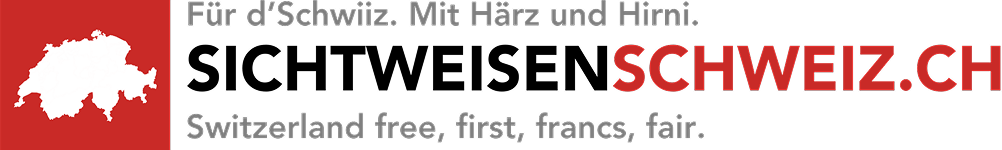







Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.